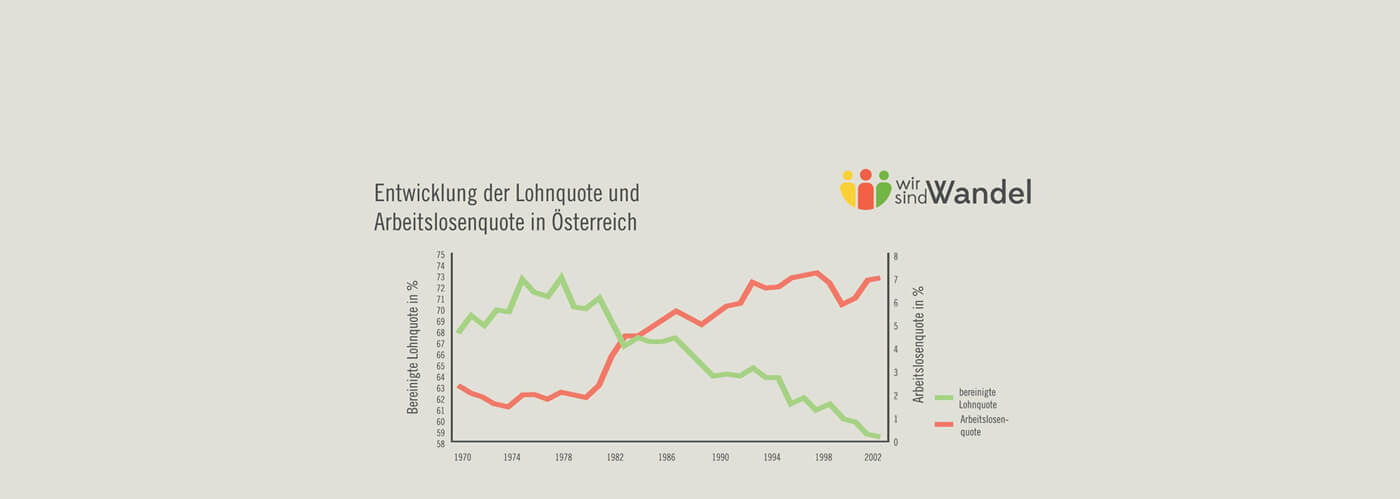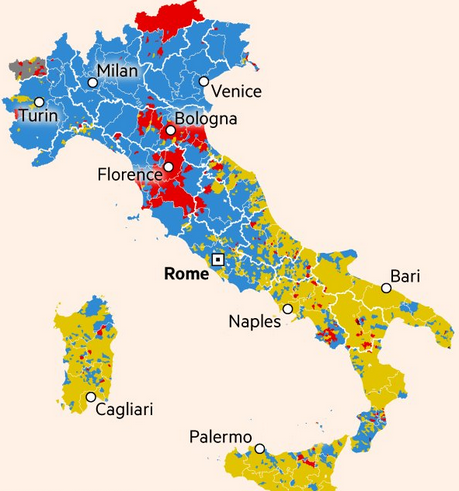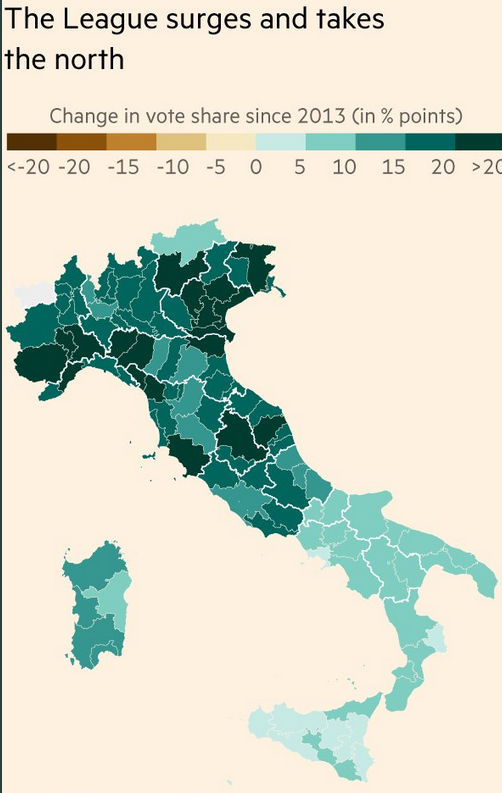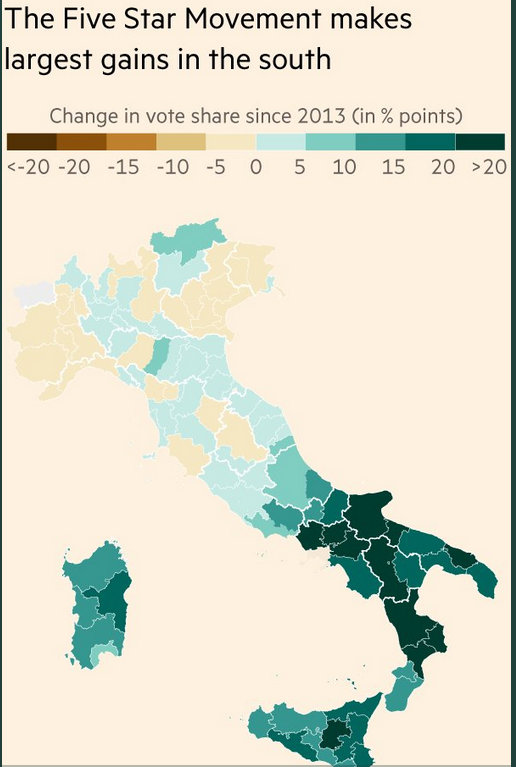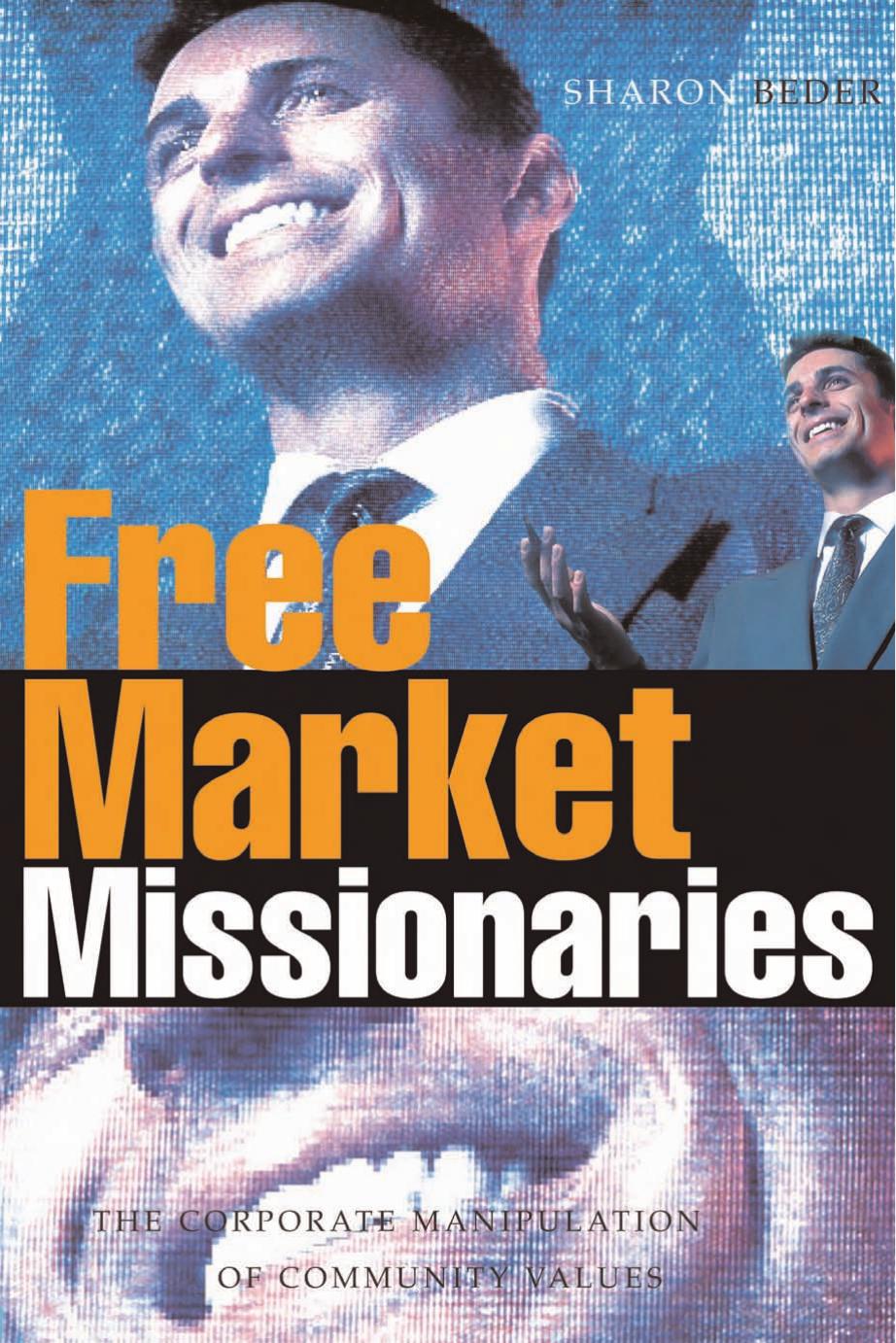Seminar „80 Jahre Anschluss“, 10. März 2018
Eine Vorbemerkung
Heinz Fischer wurde von der Bundesregierung zum Beauftragten bestimmt, das „Bedenkjahr“ in ihrem Sinn abzuwickeln. Gibt es etwas Symbolischeres, etwas, was mehr über die Rolle der Geschichte auch heute noch aussagen könnte? Der alte und noch heimliche aktuelle Bundespräsident – denn dem neuen trauen offenbar nicht einmal seine Unterstützer die nötige Fähigkeit zu – wird die Ideologie überantwortet. Das zeigt, wie wichtig die Herrschenden die Geschichte nehmen. Damit sind auch solche Erinnerungs-Daten Teil eines antihegemonialen Kampfes. Wir tun gut daran, uns damit auseinanderzusetzen. Ideologie läuft immer über die Einbettung von Interessen in einen kulturellen Rahmen – wenn es nicht so missverständlich wäre, würde ich sagen: in einen identitären Kontext.
Der Ausgangspunkt
Die Nation, dieses politische Handlungs-Konzept, entstand als Projekt der Selbstbestimmung und der Volkssouveränität. Aber schnell kapperten das aufsteigende Bürgertum und politische Eliten-Gruppen diesen Entwurf. Sie drehten das Demokratie-Projekt um und wandelten es in ein Instrument des Großmacht-Chauvinismus. Dabei stießen sie allerdings auch auf Widerstand. Unter den unterdrückten Bevölkerungs-Gruppen fanden sich Intellektuelle, welche die emanzipative Potenz des neuen Begriffs erkannten. So standen sich Ende des 19. Jahrhunderts zwei recht unterschiedliche Ausprägungen der Idee Nation gegenüber. Den chauvinistischen und imperialistischen Großmacht-Nationen der neuen und auch zunehmend der alten Eliten traten neue Bewegungen gegenüber, die sich auch als Nationen sahen – erst in Europa, doch zunehmend auch in den außereuropäischen Peripherien, in Lateinamerika, in Ägypten, in Indien.
Im Habsburger-Staat entstand aus diesem Konflikt die sogenannte „nationale Frage“. Die oppressive Strömung orientierte sich am Bismarckianismus und Wilhelminismus. Die meist deutschsprechende Bürokratie allerdings war in ihrer Loyalität zwischen deutschem Chauvinismus und autoritär-vornationalen Neigungen zerrissen. Die Großbourgeoisie war auch damals bereits a-national. Aber insbesondere die Intellektuellen waren nahezu durchwegs nationalistisch deutsch. Ihnen standen vor allem tschechische, slowenische und italienische Angeordnete gegenüber, welche in der Selbstbestimmung ihrer präsumptiven Nationen ihre Zukunft sahen, als kleine Nationen (Hroch 2000, 2001). (Die Polen hingegen waren in der Mehrzahl Stützen des alten Systems.)
1918 zerfiel dieses „Monstrum“ (S. Puffendorf 1667 über das Alte Deutsche Reich). Die deutschprechenden Österreicher standen damit vor einem unerwarteten Problem. Sie hatten plötzlich einen eigenen Staat, aber einen Kleinstaat. Die möglichen Objekte der Herrschaft – und auch der Ausbeutung – waren ihnen abhanden gekommen. Sie sollten nun selbst eine kleine Nation darstellen, selbstbestimmt, aber ohne Peripherien. Die politische Klasse, noch immer in Großmacht-Illusionen verwurzelt, war dazu nicht bereit. Stellten sie selbst schon keine Großmacht mehr dar, so wollten sie zumindest Teil einer solchen sein. Sie optierten geschlossen für den Anschluss an das Deutsche Reich.
Die Bevölkerung war zumindest geteilt. Wir haben eine ganze Reihe von Zeugnissen: Die Politiker fürchteten daher eine Volksabstimmung, auch damals schon, weil sie glaubten, sie wahrscheinlich zu verlieren. Die deutschen Imperialisten hatten auch schon gezeigt, wie es aussehen würde: Deutsche Truppen waren unmittelbar bei Kriegsende in Tirol und Salzburg einmarschiert und erst auf Druck der Entente wieder zurück gezogen worden. Die Entente verbot darauf hin formell der Anschluss, weil sie das geschlagene Deutsche Reich nicht auch noch stärken wollten.
1918 – 1922: Verhinderte Revolution; Transformismus; der ökonomisch-soziale Crash
Im Jänner 1918 waren die österreichischen Arbeiter und auch andere Gruppen nicht mehr bereit, den deutsch-habsburgischen Krieg mitzutragen. Eine breite Streik-Bewegung, beginnend in Wiener Neustadt, schien den Impuls der Oktober-Revolution aufzunehmen. Die Sozialdemokratie kam in Panik. Zusammen mit den Repressions-Kräften des alten Regimes gelang es ihr nochmals, die militanten Arbeiter zu überlisten. Lobend merkte das kaiserliche Kriegsministerium an: „Die sozialdemokratischen Führer [bemühten sich] … mit Erfolg … um die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung in den Betrieben“ (zit. bei Hanisch 1994, 273). Und der konservative Historiker hebt die „geschmeidige Taktik“ des Friedrich Adler und Otto Bauer hervor: „Der Primat der Ruhe und Ordnung setzte sich durch“ (a.a.O., 269). Bei Hautmann (1971, 1972) kann man nachlesen, wie sie die Arbeiter mit Räte-Phrasen austricksten. Die Proletarier vertrauten noch immer „ihren“ Gewerkschaften und der Partei. Die Sozialdemokratie aber lernte dazu. Als im Oktober die Fronten endgültig zusammen brachen, wurde sie als erste Partei aktiv. Die Ausrufung der Republik war, später eingestanden, vor allem eine taktische Bewegung, um den Massen eine Revolution vorzuspielen. Einige materielle Zugeständnisse an die Bevölkerung sollten ihnen den Eindruck vermitteln: Es tut sich was. Im Übrigen aber – so vor allem Otto Bauer – sind wir nicht imstande, allein etwas zu machen und müssen uns an das Deutsche Reich anschließen. Die „österreichische Revolution“, wie es Bauer 1923 beschönigend nannte, reduzierte sich auf einen Firmenwechsel beim alten Staatsgebäude.
1922: Das Programm der Konservativen – der Crash der Republik
Die Erste Republik musste nicht zuletzt aus dieser Ausgangs-Situation her zum Misserfolg werden. Die politische Klasse und ihre Sprachrohre sprachen von der „Lebensunfähigkeit“ des neuen Österreich und meinten damit ihren Unwillen, eine eigenständige Politik zu betreiben. Hier spielten vor allem die Sozialdemokraten eine verhängnisvolle Rolle, und nicht zuletzt Otto Bauer als Person. „Seine revolutionäre Phraseologie stand in krassem Gegensatz zu seine Zurückschrecken vor jeder entscheidenden Handlung“ (Kaufmann 1978, 147 f.). Die Konservativen dagegen, die tendenziell gegen den Anschluss waren, zogen eine Wirtschafts-Politik durch, welche die Bevölkerung so drangsalierte, dass diese nur mehr nach Erlösung anderswohin schaute.
Der erste Streich war die sogenannte Genfer Sanierung. Bei den Christdemokraten hatte inzwischen Ignaz Seipel das Sagen, der blutige Prälat – „Man muss schießen, schießen, schießen“ waren seine Letzten Worte auf dem Totenbett. 1922 war es noch nicht so weit. Damals manövrierte Seipel noch in einer Weise, die uns inzwischen bekannt ist. Er benutzte das Ausland, um seine Politik als unabänderlich notwendig durchzubringen. Die Christlichsozialen, seit 1920 mit den Großdeutschen am Ruder, hatten es bislang vermieden, gegen die Finanzspekulanten vorzugehen. Dabei trafen die Folgen auch und nicht zuletzt die eigene Klientel. „Was sie [die Regierungen] an der österreichischen Wirtschaft verbrochen haben, konnte nie mehr gut gemacht werden“ (K. Ausch, zit. in: Schausberger 1978, 95). Folge war die Hyper-Inflation. In Genf ließ Seipel sich die Wirtschaftspolitik vorschreiben, die er gerne führen wollte. Diesen Trick spielte in der Gegenwart auch wieder die spanische Regierung, und in bescheidenerem Maßstab spielen ihn alle Regierungen der EU. Der Inhalt dieser Politik entsprach wirtschaftlich und sozial dem, was heute die Troika, die „Institutionen“ des Tsipras und Varoufakis, in Griechenland tut.
Diese Parallele fiel auch österreichischen Zeitungen der letzten Jahre auf. In den Salzburger Nachrichten, 18. Jänner 2018: „Als Österreich Griechenland war“, kann es der Journalist nicht lassen, die Phrase von der Nicht-Lebensfähigkeit Österreichs zu wiederholen. – Auch in der Presse, 14. Juli 2015 finden wir es: „Als Österreich eine Art Griechenland war“. Die Presse und vor allem ihre Leserbrief-Schreiber kommen nicht umhin, das damalige Österreich und seine Pakttreue lobend hervorzuheben – das Land habe ja keine „linksradikale Regierung“ gehabt. Schließlich findet man diese Phrase auch in einer Broschüre der Grünen Bildungswerkstatt (2014: Als Österreich Griechenland war: Krisenpolitik damals und heute).
Das ging weit über die reine Wirtschaftspolitik hinaus. Die parlamentarische Demokratie wurde faktisch sistiert (Ermächtigungsgesetz, BGBl 844 vom 3. Dezember 1922). Und auch das kennen wir aus der EU, und zwar nicht erst nach der Finanzkrise. Auf dem Weg zum €-Regime hat z. B. Belgien unter seinem Premierminister Jean-Luc Joseph Marie Dehaene1996 die Budgetrechte seines Parlaments – als den Kern der Politik schlechthin – sistiert, um die berüchtigten Maastricht-Kriterien zu erreichen.
Das war in Genf vereinbart worden. Es war ein Notstandsregime. Anstelle des Parlaments trat ein „Außerordentlicher Kabinettsrat“, in dem sich die Regierung die Zwei-Drittel-Mehrheit gesichert hatte (BGBl 842: Genfer Protokolle vom 4. Oktober 1922). Über dem allen schwebte der Völkerbund-Kommissar Zimmermann als Kontrollor. Damit konnten nun alle Maßnahmen „im Verordnungsweg“, also durch simplen Regierungsbeschluss, durchgesetzt werden. Erinnern wir uns vielleicht hier wieder an Carl Schmitt: Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand bestimmt.
Das entsprechende „Wiederaufbaugesetz“ (BGBl 843) lässt sich nicht an seinen Einzelmaßnahmen verstehen. Die meisten Einzelmaßnahmen machen durchaus Sinn. Ich möchte einen Vergleich bringen: Regime wie jenes des Xi Jin-ping in China fahren gern Anti-Korruptions-Kampagnen. Jeder einzelne Betroffene verdient seine Behandlung dreimal. Aber es geht um ganz was Anderes. Die Kampagne ist schlicht ein Instrument im Machtkampf. Wichtiger ist noch wer nicht betroffen ist. So auch hier. Man kann das ganze Gesetz samt Anlagen lesen, und wird den Ablauf nicht verstehen. Es geht mehr darum, was nicht im Gesetz steht. Es war ein Crash-Programm, welches bisher der Bevölkerung noch nicht zugemutet worden war. Die Sozialdemokratie aber sprach sich zwar im Parlament scheinheilig dagegen aus, spielte aber mit – sonst wäre es auch gar nicht möglich gewesen. Später, schon im Austrofaschismus, wird dies Schuschnigg (1937) den Sozialdemokraten halb spöttisch, halb empört vorhalten. Die Sozialdemokratie hatte selbst bereits der Regierung Schober vorgeschlagen, die Lebensmittel-Subventionen abzubauen. Diesen Teil griffen die Herrschenden gern auf.
Es gab auch sonst genug, was da an Korruption (z. B. zugunsten der Beamten) aus der Monarchie in die Republik mitgeschleppt worden war. Den zweiten Teil, der im sozialdemokratischen Vorschlag auch enthalten war, nämlich eine expansive Wirtschaftspolitik und eine gewisse Beschränkung der Spekulation, dachte sie keineswegs aufzunehmen. Seipel hatte bereits 1921 zum ersten Mal mit einem Putsch gedroht und konkrete Planungen dafür eingeleitet. Für ihn war die Genfer „Sanierung“ vor allem eines: Ein Mittel, um den „Revolutionsschutt“ wegzuräumen. Und dabei hatte er Erfolg. Das haben die Zeitgenossen auch begriffen. Es ging das Wort um, und zwar sogar auch in konservativen Zirkeln: Seipel habe sich mit dem Völkerbund-Kommissar einen Vergewaltiger geholt (zit. bei Sandgruber 1995, 361). Für heute ist die Parallele unübersehbar – im Kleinen in Österreich und im Katastrophalen in Griechenland, Portugal, Spanien usw.: Das Programm wurde von Außen in neokolonialer Weise gegen die den Großteil der Bevölkerung durchgesetzt.
Hier gibt es noch ein Detail zu erwähnen. Der Assistent Zimmermanns war ein gewisser Meinoud Rost van Tonningen. Er wird auch wieder Völkerbund-Kommissar bei der Lausanner Anleihe 1932. Damals wurde die wirtschaftspolitische Kur von 1922 nochmals wiederholt. Dieser Rost van Tonningen wird in den österreichischen Geschichtsbüchern gewöhnlich schamhaft verschwiegen. Er war ein niederländischer Nazi, der dann in der Besatzungszeit den einheimischen Büttel für die Nazis stellte und die Niederlande an das Deutsche Reich anschließen wollte. 1945 sprang er aus dem Fenster, als ihn die Briten nach der Gefangennahme erkannten …
Erst 1929 hatte man wirtschaftlich das Vorkriegs-Niveau wieder erreicht (Butschek 1985; Kausel 1985) – und dann kam der Zusammenbruch der Creditanstalt und die Weltwirtschaftskrise. Im Jahr 1937 war man wieder bei 90 % des Niveaus von 1913 angelangt. Die Zwischenkriegszeit war für Österreich eine verlorene Epoche.
Die Austrofaschisten zerstörten auch formell die Parlamentarische Demokratie. Als 1938 sodann die Nazis einmarschierten, wurden sie von einem Teil der Bevölkerung, und vermutlich war es die Mehrheit, tatsächlich als Erlöser aus dieser Misere begrüßt.
Das war die materielle Seite. Sie musste noch ideologisch abgedeckt werden, und das war seit Langem vorbereitet.
Großmacht und Nation
Die Idee der Nation war aus unterschiedlichen Wurzeln gewachsen. Herder sah sie noch als Ausdruck einer Selbstbestimmung der Bevölkerung. Doch schon bei Siéyès wurde daraus die politische Organisation des Bürgertums. Aus der Volkssouveränität wurde damit die nationale Souveränität einer aufstrebenden Klasse. Diese Klasse, im Konkreten das französische Bürgertum, aber strebte bald die eigene Dominanz über Europa an. Ihre Konkurrenten lernten schnell. Und zu diesen Konkurrenten zählte nicht nur John Bull, die Verkörperung des britischen Bürgers. Auch die deutschen Juncker erkannten seine Potenz, selbst wenn sie, wie Bismarck, rabiat antinational waren. Sie nahmen dieses Konzept der Großmacht-Nation in ihren eigenen Dienst. Damit war die Nation, sobald sie aus dem Bereich der politischen Theorie heraus trat, die Herrschafts-Konzeption der Klassen und Cliquen an der Macht in den europäischen Großmächten.
Die „kleinen Nationen“
Doch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stieß dieser chauvistische Expansionismus der Großmacht-Nationen zunehmend auf Widerstand. Beriefen sich die nationalistischen Propagandisten des neuen deutschen Reichs auf J. G. Herder – nun, so konnten die Tschechen, Polen, Slowenen sich auf das sog. Slawen-Kapitel bei ihm berufen: Dort hatte der Geschichts-Philosoph freundliche Worte über die Emanzipations-Bestrebungen dieser damals völlig im Schatten stehenden Gruppierungen gesprochen. Er wird sowieso ganz zu Unrecht stets als völkischer Ideologe angeführt. Er war vielmehr eine Art deutscher Rousseau gewesen, der von Fichte zum Nationalisten umgedeutet worden war, und mit Fichte dann von den präfaschistischen Historikern wie Heinrich Treitschke. Und seitdem gilt er für die vielen Auch-Theoretiker, die sich nicht die Mühe machen, ihn im Original zu lesen, als solcher. Aber das ist hier keineswegs das Problem.
Finnen, Norweger, Baltische Gruppen, auch die Tschechen oder Okzitanen, Bretonen und Korsen und südslawische Nationen in statu nascendi waren periphere Bevölkerungen, politisch wie sozio-ökonomisch, im Europa der deutschen, russischen oder französischen Großmächte. In Italien hatte sich Piemont soeben Süditalien und Sizilien unter den Nagel gerissen. Diese Bevölkerungsteile wurden als willige oder auch unwillige Objekte der Ausbeutung betrachtet. Sie sollten sich ducken und an die zentralen Gruppen sprachlich assimilieren, d. h. unterwerfen. Studenten aus diesen Teilen lasen nun auch ihren Herder und ihren Rousseau.
Die Auseinandersetzung zwischen Großmacht und „kleinen Nationen“, zwischen dem chauvinistischen Nationaismus / Imperialismus und dem emanzipativen Nationen-Verständnis intern kolonialisierter Gruppen machte um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert das aus, was man die „nationale Frage“ nannte.
Ich wurde vor rund einem Jahrzehnt einmal nach Oslo eingeladen, um im Rahmen des Norwegischen Nationalprojekts über den Fall Österreich zu referieren. Die Idee dahinter war: Auch Österreich ist oder war eine „kleine Nation“. Allerdings ist dies ein Missverständnis. Die österreichische politische Klasse hat sich nach 1918 keineswegs als kleine Nation verstanden. Wenn man einen Vergleich sucht, dann bietet sich nicht etwa Norwegen an: Norwegen hat sich 1809 / 1905 in einem Unabhängigkeits-Konflikt auf eine ähnliche Weise gegen eine Großmacht – oder das, was davon geblieben war – gewandt, wie die Tschechen vor 1918 gegen das „deutsche“ Zentrum Wien. Wenn man einen Vergleich anstellt, müsste er mit Schweden getroffen werden. Und das könnte tatsächlich aufschlussreich sein, in den Parallelen wie in den Unterschieden.
Für die schwedische Politik war 1809 und nochmals 1903/05 etwa das gewesen, was 1918 für den deutschsprachigen Teil des Habsburgerstaats wurde: der Abschied von der Großmacht. 1809 wurde zum Anstoß, sich auf die eigenen inneren Angelegenheiten zu konzentrieren. Man hat darauf verwiesen, dass dies den Erfolg Schwedens bis zur Gegenwart ausgemacht hat. Das ist geschönt. Der Konflikt mit Norwegen zeigt: Die politische Spitze und ihre Unterstützer waren keineswegs einfach gewillt, diesen Statusverlust, wie man es sah, hinzunehmen. Als Norwegen schließlich nicht mehr zu halten war, waren diese Kreise (unter ihnen Sven Hedin) durchaus gewillt, einen Krieg zu riskieren. Lediglich der Druck von Außen verhinderte dies. Dafür mussten die Norweger auf britischen Druck hin einen König akzeptieren, und dort wiederum kam dies den Eliten und konservativen Kreisen sehr zupass. Fritjof Nansen etwa war einer jener Personen, der diesen Druck von Außen bestellt hatte…
Es ist interessant, dass man bei der Recherche nach Studien zur schwedischen Nation nur recht vereinzelt fündig wird. Dagegen gibt es in Fülle Arbeiten zu Norwegen und Finnland. Diejenigen, welche sich ihrer Identität – und d. h. ihrer Macht – sicher sind, haben kein Bedürfnis nachzufragen. Dagegen müssen sich die Anderen, die Abhängigen und Peripheren, stets aufs Neue ihrer Existenz vergewissern.
Deutschösterreichs Eliten und politische Klasse weigerten sich, sich von der Großmacht-Illusion zu verabschieden. Sie waren großteils sogar bereit, auf die eigene lokal-regionale Machtausübung zu verzichten, wenn man sie nur Teil der deutschen Großmacht sein ließ. Das erinnert akut an die Gegenwart, und nicht nur in Österreich. Auch heute ist die große Mehrheit der politischen Klasse bereit, sich einer supranationalen Bürokratie unterzuordnen – wenn es um um die Grundfrage „wer – wen“ geht. Allerdings traf dies damals nicht für alle zu. Die harten Konservativen, verkörpert von Seipel, bestanden auf ihre Klassen- und Ideen-Souveränität.
Volks-Souveränität – nationale Souveränität
Die Souveränität war ein Konzept gewesen, welches Theologen (Jean Bodin) aus der Allmacht Gottes abgeleitet und auf den Irdischen Gott, den Leviathan, den Staat projeziert hatten. Doch die Ideologen der neu aufsteigenden Schicht, des Bürgertums, wanden ihnen dieses Instrument schnell aus den Händen. Die Gesellschaftsvertrags-Theoretiker nahmen es für ihre Klasse in Anspruch und gleich auch noch für sich selbst, die Intellektuellen als Vertreter des Allgemein-Interesses. Aus dem personalisierten monarchischen Souverän war damit die Volkssouveränität geworden. Das „Volk“ allerdings, das waren die neuen Besitzenden, nicht etwa Alle. Um dies auch klar zu stellen, prägte man den Begriff der Nation und verstand darunter nur die politisch Ermächtigten. Am Beginn der Französischen Revolution stellte Siéyès klar: Der Dritte Stand, das Bürgertum, ist „die ganze Nation“. Sie hat die nationale Souveränität in den Händen.
Aber zu dieser Zeit stieg nicht nur hinter dem Bürgertum eine neue Klasse auf. Diese Klasse, die Plebeier und Proletarier, begannen auch den Kampf um Mitbestimmung und Demokratie. Die nationale Souveränität sollte – wieder – zur Volkssouveränität werden, und das Volk umfasste nun auch den Vierten Stand. Nicht so klar war noch, ob dazu auch Frauen und nicht nur Männer gehörten; aber das ist ein anderes Thema.
Diese neue Klasse allerdings war in diesem Punkt unsicher. Ein Teil ihrer Sprecher orientierte sich darauf, Teil der Nation zu werden. Ein anderer Teil aber, die marxistische Strömung, verwarf zumindest anfangs und in der Theorie die Nation als Rahmen. Sie definierte sich und das Proletariat eindeutig und ausschließlich international und internationalistisch. Die politische Praxis sah schnell anders aus. Es ist höchst kennzeichnend, dass die Erste Internationale schnell aufgelöst wurde. Die Zweite Internationale, die sich auch noch marxistisch definierte, wurde bereits von nationalen Sozialdemokratien gegründet.
Doch je nationaler die Sozialdemokratie wurde, umso internationalistischer gaben sich die Eliten, das Kapital und seine Intellektuellen. Die Sozialdemokratie wurde nicht nur national, sie wurde zeitweise chauvinistisch. National musste sie werden, wenn sie den Kampf um die Zustimmung nicht nur der Arbeiter, sondern auch der sonstigen Unterschichten mit Aussicht führen wollte. Chauvinistisch aber wurde sie, weil ihre Führer als traditionelle Intellektuelle in die Großmacht verliebt waren. Wir können dies schon an Engels beobachten. So vertraten die Sozialdemokraten nicht das Konzept der „kleinen“, der emanzipativen und demokratischen Nation. Sie rutschten sofort auf die Position der chauvinistischen Großmacht-Nation. Beim Beginn des Ersten Weltkriegs trat dies grell ins Licht. In der Zwischenkriegszeit kriegte sie sich rhetorisch wieder ein. Nun rechtfertigte die SPÖ ihren deutschen Nationalismus mit einer marxistischen Phraseologie vom großen Markt und der Lebensunfähigkeit des kleinen Landes.
Nach dem Zweiten Weltkrieg aber beschloss die Sozialdemokratie resolut, sich denen zur Verfügung zu stellen, die wirklich verfügten. In der BRD ist dafür Godesberg der Slogan schlechthin. Wir könnten aber genauso gut sagen: Maastricht. Ob da die Namen Wehner oder Brandt und Schmidt stehen, ist von geringer Bedeutung. In Österreich dauerte die Anpassung geringfügig länger. Hier ist Kreisky die beherrschende Figur. Er wurde zum Säulen-Heiligen der Mills-Liberalen. Aber aus heutiger Sicht müsste eigentlich ein zentraler Punkt störend wirken: Kreisky war von seiner ganzen Orientierung her Österreicher. Darüber allerdings schauen jene großzügig hinweg, die sich sonst nicht genug tun können in der „historisch exakten Bewältigung“ der Vergangenheit.
Schlussfolgerungen
Wir bezeichnen uns gelegentlich als Souveränisten. Da sollten wir vorsichtig sein. Nicht nur ist „Souveränität“ ein der Theologie entlehnter Fetisch-Begriff; er verdunkelt somit mehr als er erhellt. Er verleitet auch politisch dazu, uns völlig auf die nationale Ebene zu konzentrieren.
Wie gefährlich dies sein kann, demonstriert uns Domenico Losurdo. Dieser italienische Neostalinist verschleiert seinen Neoliberalismus mit nur mehr dünnen neomarxistischen Worthülsen. Die Linken im Westen seien pro-imperialistisch, weil sie einseitig die Kämpfe der chinesischen Arbeiter für höhere Löhne unterstützten… Die chinesischen Arbeiter sollten ihre Bedürfnisse denen der Exportnation unterordnen (vgl. Losurdo 2017, auch 2019). Solche Ungeheuerlichkeiten wagt heute ein Propagandist des deutschen Imperialismus noch nicht zu schreiben. Wir müssen über solche Stellungnahmen reden – allerdings nicht an dieser Stelle!
Die „nationale Frage“ – man achte auf die altmodische Phrasierung! – und die „nationale Technologie“ als absoluten Angelpunkt zu betrachten führt zu leicht in diese Richtung. Damit bereiten wir wieder den Globalisten den Weg, diesen Sprechern der Eliten (etwa Albrow 1998). Aber die sind politisch sowieso die Stärkeren.
Die Nation und die nationale Identität ist eine historisch begrenzte Struktur und Erscheinung. In diesem Punkt haben die Mills-Liberalen von heute zweifellos recht. Sozialisten wussten dies bereits vor 1 ½ Jahrhunderte. Aber darum geht der Streit um die Nation heute keineswegs. Es geht um die Frage von Selbstbestimmung und von demokratischer Gestaltung. Diese beiden Fundamentalwerte kamen unter dem massiven Ansturm der neuen, der neoliberalen Ideologie recht plötzlich und unerwartet ins Wanken. 1918 und 1938 fand der Angriff noch im Namen einer mystischen deutschen Nation statt, zu der die Österreicher gehören sollten – „ob sie das wollen oder nicht“ (FAZ vom 28. September 1983). 2008 und 2018 hat sich der Ton geändert. Aber das Ziel blieb dasselbe.
Einige Literaturverweise
Albrow, Martin (1998), Abschied vom Nationalstaat. Staat und Gesellschaft im Globalen Zeitalter. Frankfurt / M.: Suhrkampp.
Anholt, Simon (2007), Competitive Identity. The New Brand Management for Nations, Cities and Regions. Houndsmills, N.Y.: Palgrave Macmillan.
Ardelt, Rudolf G. (1986), „Drei Staaten –Zwei Nationen – Ein Volk“ oder die Frage: „Wie deutsch ist Österreich?“ In: Zeitgeschichte 13, 253 – 268.
Bauer, Otto (1976 [1923]), Die österreichische Revolution. In: Werke, Bd. 2. Hg. von Hugo Pepper. Wien: Europa Verlag.
Berger, Peter (2000), Im Schatten der Diktatur. Die Finanzdiplomatie des Vertreters des Völkerbundes in Österreich, Meinoud Marinus Rost van Tonningen, 1931 – 1936. Wien: Böhlau.
Butschek, Felix (1985), Die österreichische Wirtschaft im 20. Jahrhundert. Wien/Stuttgart: WIFO / G. Fischer.
Hanisch, Ernst (1994), Der lange Schatten des Staates. Wien: Ueberreuter.
Hautmann, Hans (1971), Die verlorene Räterepublik. Am Beispiel der Kommunistischen Partei Deutschösterreichs. Wien: Europa Verlag.
Hautmann, Hans (1972), Rätedemokratie in Österreich 1918 – 1924. In: ÖZP 1, 73 – 88.
Heer, Friedrich (1981), Der Kampf um die österreichische Identität. Wien/Köln/Graz: Böhlau.
Hroch, Miroslav (2000 [1985]), Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations. New York: Columbia University Press.
Hroch, Miroslav (2001a), Die kleinen Nationen und Europa. In: Acta Historica Tallinnensia 5, 7 – 15.
Hroch, Miroslav (2001b), Der Aufbruch des Nationalismus im postkommunistischen Europa. In: Timmermann, Heiner, Hg., Nationalismus in Europa nach 1945. Berlin: Duncker & Humblot, 93 – 99.
Kaufmann, Fritz (1978), Sozialdemokratie in Österreich. Idee und Geschichte einer Partei. Von 1889 bis zur Gegenwart. Wien: Amalthea.
Kausel, Anton (1985), 150 Jahre Wirtschaftswachstum in Österreich und der westlichen Welt im Spiegel der Statistik. Wien: Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei.
Kausel, Anton (1968), Österreichs Wirtschaft 1918 – 1968. Wien: Verlag für Geschichte und Politik.
Kausel, Anton / Nemeth, Nandor / Seidel, Hans (1965), Österreichs Volkseinkommen 1913 – 1963. Wien: WIFO.
Losurdo, Domenico (2017), China und das Ende der ‚kolumbianischen Epoche’. In: Marxistische Blätter, Heft 3, 52 – 61.
Losurdo, Domenico (2010), Eine aufschlussreiche Reise nach China: Bemerkungen eines Philosophen. In: Marxistische Blätter, Heft 6,
Sandgruber, Roman (1995), Ökonomie und Politik. Österreichische Wirtschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Wien: Ueberreuter.
Schausberger, Norbert (1978), Der Griff nach Österreich. Der Anschluß. Wien: Jugend und Volk.
Schuschnigg, Kurt (1937), Dreimal Österreich. Wien: Thomas Verlag Jakob Hegner.
 Auch Oppositionsführer Jeremy Corbyn meldete sich zu Wort. Er forderte „eine“ Zollunion mit der EU, jedoch derart, in der die Bestimmungen des Lissabon-Vertrages unwirksam sind. Es gehe der Labour und der Linken in Britannien darum, nicht der Regulierungshoheit Brüsseler Institutionen über einen Binnenmarkt unterworfen zu sein. Zölle im Allgemeinen seien verhandelbar, meinte er und bekannte sich zur Zollfreiheit zwischen den EU-Ländern und Britannien im Besonderen. Ob er da nicht einem realitätsfernen Traum aufsitzt? Britannien kann nicht – schon alleine nicht mit Rücksicht auf das Commonwealth – wie die USA Exportdefizite durch Innenverschuldung, sprich Vermehrung des umlaufenden Geldes, ausgleichen. Wird im UK doch wieder der kleine Mann zur Kasse gebeten, damit das Land seine Schulden bei der EU, speziell bei Deutschland bezahlen kann? Oder bleibt es Britannien doch nicht erspart, Zollbestimmungen gegenüber der EU einzuführen, so wie es Mr. Trump mit Stahl und Aluminium gegenüber EU (meinen tut er Deutschland) angekündigt hat. Aber hätte Britannien die Kraft dazu? Zollfragen sind Machtfragen. Auch geopolitische und globale Machtfragen. Vor 100 Jahren konnte Britannien solcherart Position erfolgreich durchsetzen. Aber heute?
Auch Oppositionsführer Jeremy Corbyn meldete sich zu Wort. Er forderte „eine“ Zollunion mit der EU, jedoch derart, in der die Bestimmungen des Lissabon-Vertrages unwirksam sind. Es gehe der Labour und der Linken in Britannien darum, nicht der Regulierungshoheit Brüsseler Institutionen über einen Binnenmarkt unterworfen zu sein. Zölle im Allgemeinen seien verhandelbar, meinte er und bekannte sich zur Zollfreiheit zwischen den EU-Ländern und Britannien im Besonderen. Ob er da nicht einem realitätsfernen Traum aufsitzt? Britannien kann nicht – schon alleine nicht mit Rücksicht auf das Commonwealth – wie die USA Exportdefizite durch Innenverschuldung, sprich Vermehrung des umlaufenden Geldes, ausgleichen. Wird im UK doch wieder der kleine Mann zur Kasse gebeten, damit das Land seine Schulden bei der EU, speziell bei Deutschland bezahlen kann? Oder bleibt es Britannien doch nicht erspart, Zollbestimmungen gegenüber der EU einzuführen, so wie es Mr. Trump mit Stahl und Aluminium gegenüber EU (meinen tut er Deutschland) angekündigt hat. Aber hätte Britannien die Kraft dazu? Zollfragen sind Machtfragen. Auch geopolitische und globale Machtfragen. Vor 100 Jahren konnte Britannien solcherart Position erfolgreich durchsetzen. Aber heute?