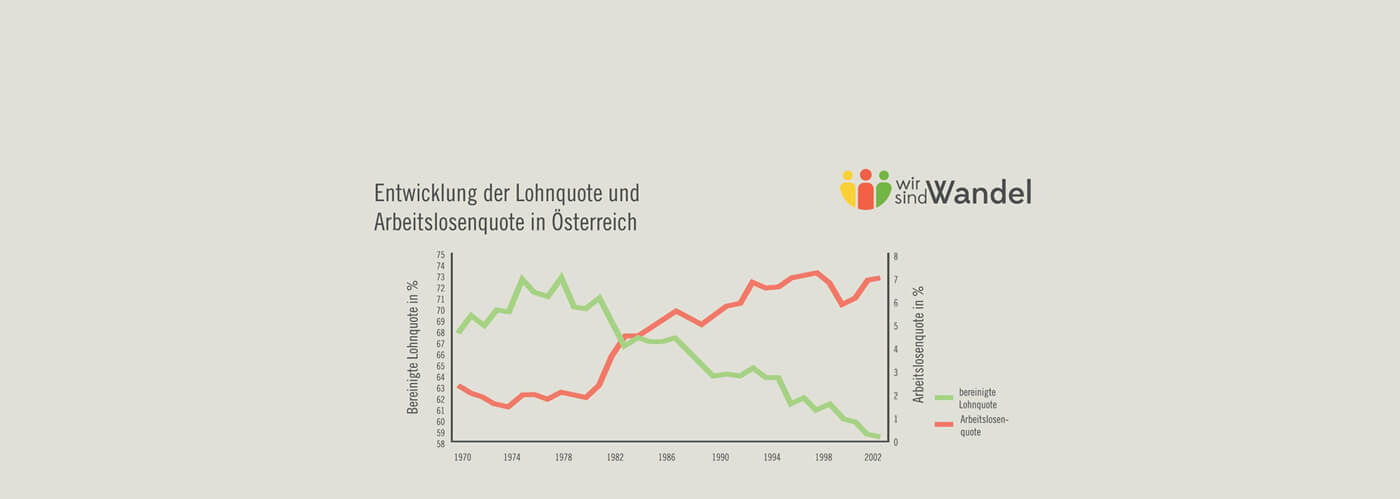von Klaus Dräger
Die spanische linkspopulistische Partei Podemos (‚Wir können es‘) hielt am Wochenende vom 11. und 12. Februar 2017 in der Madrider Stierkampfarena Vistalegre ihre zweite ’nationale Bürgerversammlung‘ (Asamblea Ciudadana) ab. Zwischen der Gründungskonferenz von Podemos im Oktober 2014 (Vistalegre 1) und diesem Kongress liegen mehr als zwei bewegte Jahre, in denen die junge politische Kraft mit einer zentralistischen Durchbruch-Strategie stärkste Partei werden und die Regierungsmacht in Spanien erobern wollte.
Bei den nationalen Parlamentswahlen im Dezember 2015 und der Wiederholungswahl im Juni 2016 kam sie mit ihren Bündnispartnern jedoch nur auf den dritten Platz, hinter Konservativen (PP) und Sozialdemokraten (PSOE). Gegenüber der Dezemberwahl verlor das von Podemos geführte Bündnis im Juni 2016 rund eine Million Stimmen.
Katerstimmung breitete sich aus, eine intensive Nabelschau begann. Richtungskämpfe um die Zukunft des Podemos-Projekts wurden intern und über die Medien mit großer Inbrunst (aber meist ohne inhaltlichen Tiefgang) ausgetragen. Vistalegre 2 sollte vor diesem Hintergrund die politische Orientierung und das Organisationsmodell der Partei auf die Herausforderung einer de-facto Großen Koalition von Konservativen und Sozialdemokraten neu einstellen, die sich mit der im Dezember 2016 installierten Minderheitsregierung von Mariano Rajoy (PP) abzuzeichnen scheint.
Die Strömungen
Es gibt zur Zeit drei Hauptströmungen innerhalb von Podemos (1) – die AnhängerInnen von Generalsekretär Pablo Iglesias, die AnhängerInnen des Politischen Sekretärs Íñigo Errejón, und die Anticapitalistas um den Europaabgeordneten Miguel Urbán und die Generalsekretärin von Podemos Andalusien, Teresa Rodriguez. Zu Vistalegre 2 legten diese ihre jeweiligen Positionspapiere zu vier Themen vor: politische Resolution (Analyse der Lage und Vorschläge für die politisch-strategische und programmatische Orientierung von Podemos), Organisationsmodell und Demokratie, zur Ethik, und zur Feminisierung der Organisation (Documento de Igualdad). Zur Feminisierung präsentierten Iglesias und Anticapitalistas einen gemeinsamen Vorschlag.
Als erster hatte der Errejón-Flügel die parteiinterne Debatte angestoßen: Podemos brauche neue Ideen für eine veränderte Lage, müsse sich weiter zur ‚Breite der Gesellschaft‘ hin öffnen, intern ein demokratischeres und dezentraleres Organisationsmodell anstreben. (2) „Die Hoffnung wieder gewinnen“ war das Motto ihrer Kampagne. Iglesias zog nach mit der Plattform „Podemos für alle“ – Regierungsübernahme in 2020 als stärkste Kraft, Zwischenschritte, 100 000 Podemos-Aktive und eine Million Sympathisanten gewinnen etc. pp.. Die Anticapitalistas propagierten „Podemos in Bewegung„, ebenfalls für mehr innerparteiliche Demokratie und Dezentralisierung, aber mit scharfer Kritik an der ‚Populismus-Hypothese‘ von Vistalegre 1 und der ‚Sozialdemokratisierung‘ von Podemos danach.
Sieg der ‚Pablisten‘
Zunächst zu den Ergebnissen: zur ‚politischen Resolution‘ gewann die Strömung um Iglesias (Podemos für alle) mit 56 %. Deutlich unterlegen waren die Texte von Errejón mit 33,7 % und der Anticapitalistas mit 8,9 %. Ähnlich die Ergebnisse in punkto Organisationsmodell und innerparteiliche Demokratie: Iglesias 54,4 %, Errejón 34,9 %, Anticapitalistas 10 %. Die gemeinsame Resolution des Iglesias-Flügels und der Anticapitalistas zur Feminisierung von Podemos erhielt 61,7 %, die Vorlage von Errejón 35, 6 %. Politisch und personell hat sich der Flügel um Iglesias auf der Konferenz Vistalegre 2 klar durchgesetzt.
Pablo Iglesias wurde mit 89,1 % der Stimmen wieder als Generalsekretär von Podemos bestätigt. Sein einziger Gegenkandidat Juan M. Yagüe erhielt nur 10, 9 %. Errejón führte die Kampagne seines Flügels mit großformatigen Postern, die Iglesias und ihn selbst als das alte und neue Führungsduo von Podemos zeigten. Für die Funktion des Generalsekretärs kandidierte er nicht. Seine Strategie (unterstützt von vielen Medien) war: Iglesias als Frontmann von Podemos und Ikone weiter behalten, aber ihm eine andere politische Agenda aufzwingen.
Iglesias hat sich dagegen gewehrt: Er könne nicht Generalsekretär von Podemos sein, wenn eine politische Plattform angenommen würde, die er so nicht teile. Für ihn gelte: ‚Politik zuerst‘ – gäbe es eine andere politische Mehrheit innerhalb von Podemos, so müsse diese dann diesen Posten aus ihren Reihen besetzen und die Verantwortung tragen. Aus meiner Sicht: prinzipiell nachvollziehbar und soweit demokratisch.
In den spanischen Medien wurde Iglesias‘ Haltung dazu als ‚Erpressungsstrategie‘ gebrandmarkt. Da ist ein Körnchen Wahrheit dran: in einer politischen und medialen Landschaft, in der alles auf ‚Personen‘ (politische Führungspersönlichkeiten) und ihre Rivalitäten fixiert ist (und politische Inhalte und Programme nicht viel zählen), wirkt so was. Die höhere Beteiligung von Mitgliedern und registrierten SympathisantInnen an den Abstimmungen über politische Dokumente und die Wahl der Leitung von Podemos bei Vistalegre 2 kam wohl auch über diese personelle Zuspitzung zustande- von Errejón dann als ‚Plebizit für Pablo‘ gescholten.
Der nationale Bürgerrat von Podemos
Die Wahl des nationalen Leitungsgremiums von Podemos (Consejo Ciudadano Estatatal, CCE – der nationale Bürgerrat) spiegelt in etwa die gleichen innerparteilichen Kräfteverhältnisse wie zuvor bei den politischen Dokumenten. Der CCE besteht aus 62 von der nationalen Bürgerversammlung zu wählenden Mitgliedern – über diese war in Vistalegre 2 abzustimmen. Hinzu kommen später die Podemos-GeneralsekretärInnen aus den autonomen Regionen Spaniens (z.B. Andalusien, Baskenland etc.), sowie einige wenige aus den Podemos-Kreisen gewählte Delegierte usw.
Für die Wahl dieser 62 Posten war zuvor in einer Internetabstimmung der Vorschlag des Organisationssekretärs von Podemos, Pablo Echenique, zu einem neuen Wahlverfahren für Vistalegre 2 angenommen worden – das Debordo. Die Abstimmungsberechtigten konnten für die Kandidatinnen Punkte vergeben: 80 für die- oder denjenigen, die sie auf Platz 1 sehen wollten, 79 für Platz 2 … bis runter auf 19 für die letzten – also ein Präferenzsystem, ähnlich wie das ‚Kumulieren und Panaschieren‘ bei manchen Kommunalwahlen in Deutschland.
Was die Abstimmung nach diesem Punkte-System angeht, so kamen die KanditatInnen der Liste des Iglesias-Flügels auf 50, 8 %, die der Liste des Errejón-Flügels auf 33,7 % und die der Liste der Anticapitalistas auf 13,8 %. Die 62 am Ende in Vistalegre 2 gewählten Mitglieder der Podemos-Leitung verteilen sich wie folgt: 37 UnterstützerInnen von Iglesias, 23 von Errejón und 2 von den Anticaps. Wäre z.B. der in den Medien als ’sehr demokratisch‘ gepriesene Vorschlag von Errejòn zum Wahlverfahren angenommen worden, hätte sich die Anzahl seiner AnhängerInnen im Leitungsgremium ironischerweise auf 21 verringert. Die Anticaps hätten hingegen 9 Leitungsmitglieder statt nunmehr 2. Ähnliche Ergebnisse wären herausgekommen, wenn der Vorschlag der Anticaps zum Wahlverfahren gesiegt hätte. Wahlverfahren hin oder her – unter allen diesbezüglichen Szenarien hätte Iglesias die Mehrheit von Podemos sehr deutlich hinter sich.
Die spanischen Medien kommentierten: Durchmarsch für Iglesias, Errejón abrasiert. Oberflächlich betrachtet mag das stimmen. Eine Parteispaltung – wie vom telepolis-Reporter Ralf Streck an die Wand gemalt – wird es m.E. aber vorerst nicht geben. Die Errejónistas werden sich eher in einen ‚Guerillakampf‘ um die Podemos-Basis begeben – so wie z.B. die ‚ grünen Realos‘ unter Joschka Fischer dies in den 1980er Jahren in ihrer Partei auch taten (was sich für sie mit spätem Erfolg in den 1990ern auszahlte).
Was Podemos zusammen hält
Was vereint und was trennt die drei Hauptströmungen von Podemos? Wenn man die vorgelegten politischen Resolutionen vergleicht, gibt es m.E. in vielen Punkten erstaunlich breite Übereinstimmung, trotz unterschiedlicher Akzente zu diesem oder jenem Thema.
So wollen alle drei Strömungen die ‚zentralistische Wahlkampfmaschine‘, als die Podemos in den letzten beiden Jahren agierte, überwinden und in eine ’neue Phase‘ eintreten. Dezentralisierung und Demokratisierung der Organisation (mit unterschiedlichen Nuancen), mehr Partizipationsrechte der Basis, das Recht der regionalen und lokalen Untergliederungen, über ihren Kurs etc. autonom zu entscheiden usw. – dies ist der generelle Tenor in den politischen Resolutionen aller drei. Ebenso: Podemos müsse eine ’soziale und politische Bewegung‘ werden (d.h Partei als auch ’soziale Bewegung‘ sein). Diese solle im Bündnis mit anderen ‚Gegenmacht‘ am Arbeitsplatz, den Universitäten und Schulen, in den Gemeinden usw. aufbauen und als Kraft agieren, um diese Aktivitäten untereinander zu vernetzen. Ziel ist, einen (gegen)hegemonialen ‚transformatorischen Block‘ in der Gesellschaft aufzubauen, der die Herrschaft der Eliten in Spanien bricht.
Die Anticapitalistas pochen diesbezüglich – wie auch Izquierda Unida (IU, Vereinigte Linke, Teil des Wahlbündnisses ‚Unidos Podemos‘) – auf eine Strategie des ‚Ungehorsams‘ gegenüber der EU-Austeritätspolitik, fordern erneut die Vergesellschaftung der Banken und des Energiesektors. Bei Iglesias und Errejón kommt dies nicht vor. An programmatischen Vorschlägen gibt es von den drei Strömungen insgesamt nichts wesentlich Neues. Podemos‘ interne Debatten bewegen sich bestenfalls im programmatischen Spektrum der Partei der Europäischen Linken (EL). Die Strömungen von Errejón und Iglesias stehen inhaltlich für ähnliche Positionen wie der moderate Flügel der EL (3). Alle drei Strömungen kritisieren ansonsten heftig den gegenwärtigen Kurs der EU-Eliten, die Austeritätspolitik usw. und orientieren auf eine radikale Reform der gegenwärtigen EU (‚Neugründung‘). In der EL geht es in Sachen Europapolitik heftiger zur Sache …
Die Strömungen von Iglesisas (eher implizit) und von Errejón (eher explizit; mit langen Ausführungen in ihrer Resolution über ‚Transversalität‘ und ‚plebejische Ansprache der Massen‘ usw.) beziehen sich weiterhin auf die lateinamerikanische Populismusstrategie und die diesbezüglichen Theorien von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe. Beide bemühen auch die Hegemonietheorie von Antonio Gramsci, dass nun der Übergang vom ‚Bewegungskrieg‘ (direkte Eroberung der Regierungsmacht, das zentrale Thema der letzten 2 Jahre für Podemos) zum mühseligen ‚Stellungskrieg‘ (Gewinnung der Hegemonie in ‚der Gesellschaft‘, geduldiger Aufbau eines ‚historischen transformatorischen Blocks‘) angezeigt sei. Bei so viel Gleichklang in der ‚Theorie‘ – was sind dann die Unterschiede in der Orientierung für die Praxis?
Strategie und Taktik
Für die Pablistas bedeutet Gramscis Formel vom Stellungskrieg: ‚Schützengräben‘ in der Gesellschaft ausheben, Gegenmacht aufbauen, im Wesentlichen außerparlamentarisch Bündnisse gegen das ‚Regime von 1978′ organisieren. D.h.: bei jeder Protestaktion, bei jedem kleinen oder größeren Streik dabei sein, aufklären, organisieren und vernetzen. Podemos dafür als ’nützliche Kraft‘ aufstellen, mehr Mitglieder und SympathisantInnen gewinnen, als Organisation schlagkräftiger werden. Idealtypisch: tiefe Wurzeln in den Kämpfen schlagen, sich lokal und regional besser verankern und somit die vorherige Dynamik als ‚Anti-Establishment-Bürgerbewegung‘ erhalten und neue Dynamik generieren.
Für die Errejónistas bedeutet dieselbe Formel: Podemos darf sich nicht auf reinen ‚Widerstand‘ gegen Rajoy, auf ‚linke Opposition‘ etc. beschränken. Podemos muss ‚transversal‘ aus dieser Ecke heraus, um hegemoniefähig zu werden. Also: sich als ’nützliche Kraft‘ erweisen, indem man auf parlamentarischer Ebene punktuelle Bündnisse mit PSOE, den Liberalen von Ciudadanos und den Regionalisten (Baskenland, Galicien, Katalonien usw.) zu diesem oder jenem Thema schließt. Und der konservativen Minderheitsregierung von Mariano Rajoy so Parlamentsbeschlüsse aufdrückt, die diese gar nicht will. Dafür müsse man die programmatischen Positionen von Podemos nochmals abschwächen, einen ‚dialogischen Stil‘ statt eines ‚konfrontativen‘ pflegen usw..
Dieser Diskurs Errejóns steht m.E. im Widerspruch zur von ihm weiterhin hoch gehaltenen ‚populistischen Strategie‘ im Sinne Laclaus: scharfe Frontstellung das ‚Volk‘ gegen die ‚Eliten‘, ‚Wir‘ gegen ‚die da oben‘ (4). Wenn dies alles auf ‚Einzelentscheidungen‘ herunter gebrochen wird, für die dann Bündnisse mit den hart kritisierten Eliten erforderlich sind, dann löst sich die von den beiden Hauptströmungen von Podemos propagierte Folie des Populismus in Rauch auf.
Iglesias hielt dagegen: Die konservative Minderheitsregierung von Rajoy kann mit Dekreten regieren, progressive Mehrheitsbeschlüsse des spanischen Parlaments so abwandeln, verzögern, außer Kraft setzen etc.. Die Chancen für ’nützlichen Wandel‘ auf dieser institutionellen Schiene seien minimal und sehr begrenzt. Errejóns Strategie erlaube der PSOE und den liberalen Ciudadanos, sich weiterhin als ‚Opposition‘ aufzuführen und sie aus ihrer Verantwortung zu entlassen, eine de-facto Große Koalition mit Rajoy geschmiedet zu haben. Die notwendige ‚historische Transformation‘ gerate so aus dem Blick. Podemos würde nur als der nächste Kandidat für die teilweise ‚Modernisierung‘ im immer gleichen Spiel der alten Elitenherrschaft wahrgenommen, ohne diese grundlegender zu verändern.
Wachstumsprobleme
Hinter diesem leidenschaftlich und manchmal in beleidigenden Schlammschlachten ausgetragenen Konflikt um ‚Strategie und Taktik‘ steht m.E. ein ‚objektives‘ Dilemma. Podemos und das breitere Wahlbündnis ‚Unidos Podemos‘ (mit IU und den regionalen ‚Confluencias‘) sind stark bei den jüngeren Generationen, generell bei WählerInnen mit guten Bildungsabschlüssen ab Abitur etc.. Iglesias will – soziologisch gesehen- in jene Schichten der Bevölkerung vorstoßen, die niedrigere Bildungsabschlüsse haben (also NichtwählerInnen und PSOE, wg. deren Krise). Das könnte ein ‚Nullsummenspiel‘ werden – PSOE verliert, UP gewinnt – keine wesentlichen Zugewinne aus dem rechten Lager, keine starke ‚links-alternative Mehrheit‘ – aber besser als nichts.
Errejón will aus dem rechten Lager (von PP und C’s, und ansonsten auch von NichtwählerInnen und PSOE) hinzu gewinnen – und dafür Podemos ‚programmatisch abrüsten‘. Die politische Resolution seiner Strömung hatte deshalb z.B. viele ‚Ideen‘ zur Gemeindereform, zur Situation der ländlichen Regionen (wo die PP stark ist) und zum ‚Patriotismus‘ als Leitideologie vorgetragen, um ’neue transversale Fronten‘ in dieser Hinsicht aufzumachen.
Das Dilemma: die meisten WahlforscherInnen in Spanien sind sich einig, dass Podemos bei der Umsetzung von Errejóns Strategie ‚links‘ und im ‚alternativ-progressiven Milieu‘ deutlich mehr verlieren würde, als in der Mitte oder Rechts hinzu gewonnen werden könnte. Und so erklärt sich m.E. auch, warum die ‚Pablisten‘ den Richtungsstreit innerhalb von Podemos gewannen: das Erreichte konsolidieren (das Wahlbündnis ‚Unidos Podemos‘ hat immerhin rund ein Fünftel der Wählerschaft im Rücken), sich besser verankern und verwurzeln, allmählich wachsen und schlagkräftiger werden – das ist erstmal die Hoffnung der Mehrheit (und auch der Anticapitalistas).
Bündnispolitik
Ein zweite wesentliche Konfliktlinie war: wie weiter mit dem Wahlbündnis Unidos Podemos? Errejóns Flügel beharrte darauf, dass das Bündnis mit den ‚Kommunisten‘ von Izquierda Unida ein gravierender Fehler war, weil Podemos damit in die ‚linke Ecke‘ geriet. Iglesias und Anticapitalistas träumen eher davon, dass die ‚confluencias‘ (der ‚Zusammenfluss‘ von Podemos, IU, den spanischen Grünen ‚Equo‘, plus die regionalen Bündnisse in Katalonien, Galicien usw. im Wahlbündnis Unidos Podemos, plus das Bündnis ‚Compromis‘ in der autonomen Region Valencia mit ähnlichen Kräften) perspektivisch zu einer breiter aufgestellten politischen Formation zusammengeführt werden könnten.
Errejón hingegen möchte bestenfalls wieder gemeinsame Wahlbündnisse eingehen, aber Podemos als unabhängiges ‚Zentrum‘ und führende Kraft der ‚confluencias‘ bewahren. In einigen spanischen ‚autonomen Regionen‘ ist dieser Zug schon abgefahren – in Katalonien will sich das dortige Bündnis in eine autonome Partei formieren (derzeit die stärkste auf regionaler Ebene), in Galicien lanciert das Bündnis En Marea eine neue Partei, und auch in Andalusien – Hochburg der Anticaps – befindet sich En Marea Andaluza in Gründung. Die Partner von Podemos – nicht nur in den autonomen Regionen (mit starken nationalen Minderheiten), sondern auch auf zentraler Ebene – waren von den internen Auseinandersetzungen in der Partei vor Vistalegre 2 eher irritiert. Sie warten darauf, dass auch auf nationaler Ebene entsprechende Prozesse für eine weitere Verständigung und Zusammenschlüsse in Angriff genommen und nicht durch die innerparteilichen Kontroversen von Podemos blockiert werden. Eine komplizierte Gemengelage für die junge Partei …
Podemos‘ Exekutive
Nach intensiven Verhandlungen des neu gewählten Generalsekretärs Pablo Iglesias mit den Minderheitsströmungen innerhalb von Podemos ergab sich am 18.2.2017 für die Besetzung der operativen Leitung der Partei folgendes Bild:
• Íñigo Errejón bleibt nicht mehr länger ‚Super-Polit-Sekretär‘ der Partei, also die ‚Nummer Zwei‘ nach Iglesias. Diese Funktion wird abgeschafft. Er wird Chef der Abteilung ‚Politische Analyse und Strategien für den Wandel‘ von Podemos und soll als Spitzenkandidat bei der Wahl in der Großregion Madrid gegen die amtierende Regierungspräsidentin Cristina Cifuentes (PP) in 2019 antreten.
• Errejón ist auch nicht länger Koordinator der Fraktion ‚Unidos Podemos‘ im spanischen Parlament; diese Funktion geht an Irene Montero vom Iglesias-Flügel.
• SprecherInnen der Partei werden der bisherige und künftige Organisationssekretär Pablo Echenique sowie Noelia Vera, bislang für Bündnispolitik zuständig.
• in der Podemos-Exekutive sind Mitglieder der Errejón-Strömung (z.B. Pablo Bustinduy und Auxiliadora Honorato) sowie der Anticapitalistas (Miguel Urban) vertreten.
• Iglesias stellt ein ‚Schattenkabinett‚ für die künftige angestrebte ‚UP-geführte Regierung‘ auf, die ein Regierungsprogramm für die nächste Wahl in 2020 erarbeiten soll; innerparteiliche Minderheiten sind darin vertreten (z.B. Errejón, Urban, etc.).
Also jetzt alles in Butter bei Podemos – ‚klare Verhältnisse‘, ‚Pluralität‘ gewahrt und innerparteilicher Ausgleich gesichert? Jetzt alle nach vorne blicken, ‚gemeinsam in die Hände gespuckt und ran‘ an den ‚Hauptgegner PP‘? Wird Iglesias Strategie funktionieren? Dafür sind zumindest viele Hürden zu überwinden.
Fragile politische Verhältnisse in Spanien
Die im Dezember 2016 durch Ciudadanos und durch Enthaltung der PSOE-Fraktion ermöglichte Minderheitsregierung der Konservativen hat bislang von harten Ausgabekürzungen (wie in 2011/12) abgesehen. Um die von der EU-Kommission vorgeschriebenen Ziele zur Reduzierung des Haushaltsdefizits zu erreichen, hat sie in einem Deal mit der PSOE Steuerschlupflöcher und Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen gestrichen sowie Mehrwertsteuern auf Alkohol, Tabak und zuckerhaltige Getränke erhöht. Den Rest für die Haushaltskonsolidierung werde das anhaltende Wirtschaftswachstum besorgen. Rajoy hat sogar den Beschluss des spanischen Parlaments zur Erhöhung des Mindestlohns übernommen – Podemos stimmte übrigens auch dafür. Weitere sozialpolitische Verbesserungen stellt Rajoy in Aussicht, falls die spanische Wirtschaft deutlich wächst.
Die konservative Minderheitsregierung fährt damit einen ähnlichen Kurs wie die Große Koalition in Deutschland unter Merkel. Das Kalkül der PSOE lautet: ohne uns kann Spanien nicht regiert werden, Rajoy muss soziale Zugeständnisse machen. Dass ein neuer Aufstand der Indignados (der Empörten) sich entwickeln könnte, wollen PP und PSOE so verhindern. Unter diesen Bedingungen ‚Gegenmachtpositionen‘ auf der Straße, in den Betrieben usw. aufzubauen, wie Podemos es vorschwebt, dürfte nicht so einfach werden.
Noch ist die de-facto Große Koalition (formell eine von den ‚Oppositionsparteien‘ Ciudadanos und PSOE von Fall zu Fall tolerierte Minderheitsregierung der PP) nicht konsolidiert. In der PSOE tobt der innerparteiliche Kampf um die künftige Führung und Ausrichtung der Partei. Im Mai 2017 laufen Urwahlen zur Position des Generalsekretärs, im Juni findet der Parteitag statt. Hierzu tritt auch der ehemalige PSOE-Generalsekretär Pedro Sanchez wieder an, den die Parteigranden in einem Putsch aus dem Amt entfernt hatten. Er wirbt mit seinem Credo: „Nein zur Regierung Rajoy“. Dies tut auch der zweite Kandidat Patxi López von den baskischen Sozialisten. Er hatte sich allerdings bei der Abstimmung über Rajoy enthalten und hat somit ein Glaubwürdigkeitsproblem. Die hauptsächliche Gegenkandidatin zu Sanchez ist Susana Diaz, die Ministerpräsidentin von Andalusien. Sie zog gemeinsam mit dem ehemaligen PSOE-Ministerpräsidenten Felipe Gonzàlez die Strippen beim Sturz von Sanchez.
Die Regionalfürsten der PSOE (‚barones‘) und der Parteiapparat befürchten nun eine ‚populistische Welle‚ unter den Parteimitgliedern – wie in Großbritannien, wo Linksaußen Jeremy Corbyn sich gegen Putschversuche der Anhänger von Tony Blair an der Spitze von Labour behauptete, oder wie in Frankreich, wo Benoit Hammon vom linken Flügel der PS die Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur der Sozialisten gewann. Sollte Sanchez von der Basis erneut zum Generalsekretär gewählt werden, zögen neue Probleme für die konservative Minderheitsregierung herauf.
Die PSOE als Teil des ‚historischen transformatorischen Blocks‘?
Pablo Iglesias hofft vor diesem Hintergrund, die PSOE für den angestrebten ‚transformatorischen Block‘ zu gewinnen. Das Wahlbündnis Unidos Podemos (UP) propagierte als Alternative zu Rajoy eine Koalitionsregierung von PSOE, UP und den baskischen und katalanischen Nationalisten (baskische PNV; sozial-liberale ERC und wirtschaftsliberale CDC aus Katalonien, welche die Lostrennung Kataloniens vom spanischen Staat im November 2017 anstreben). Ein solches ‚rosa-rot-sozialliberales‘ Bündnis hätte im derzeitigen spanischen Parlament eine absolute Mehrheit der Mandate. ERC und CDC sind zu einer solchen Allianz bereit, sofern ein Referendum über die Unabhängigkeit Kataloniens zugelassen würde. Dies lehnte die PSOE stets ab. Ob Sanchez die Partei für eine ‚föderalistische Staatsreform‘ gewinnen könnte, die das Selbstbestimmungsrecht der kleineren Nationen im spanischen Staat (Galicier, Basken, Katalanen usw.) absichert, sei einmal dahin gestellt. Im Juni 2017 werden wir mehr wissen …
Sollte sich Susana Diaz als Generalsekretärin der PSOE durchsetzen, dürfte die de-facto Große Koalition erstmal Luft schöpfen. Die ‚Alternative zu Rajoy‘ (PSOE, UP, etc.) dürfte die bekannten Probleme der Mitte-Links-Bündnisse der letzten Jahrzehnte mit sich bringen, dass selbst milde sozialdemokratische Forderungen wie die von Podemos kaum umgesetzt würden. Leicht würde es für die junge Partei so oder so nicht …
[1] Es gibt auch noch eine vierte Strömung – Podemos en Equipo. Sie erreichte bei allen Abstimmungen in Vistalegre 2 (politische Dokumente, Wahlen zur nationalen Leitung usw.) nur 1 – 2 % für ihre Positionen.
[2] Bei der Gründungskonferenz von Podemos in 2014 setzte Errejón gemeinsam mit Iglesias das ‚zentralistische Generalsekretärsmodell‘ durch. Ihr gemeinsames Ziel damals war, die Anticapitalistas aus der Leitung von Podemos heraus zu halten, was ihnen gelang. Repräsentation von innerparteilichen Minderheiten in den Gremien – egal ob ‚Rechts- oder Linksabweichler‘ aus der jeweiligen Sicht des ‚Zentrums‘ – dafür hatte das Vistalegre 1-Modell keinen Platz. ‚Demokratie‘ entdecken einige wohl nur für sich, wenn sie aus einer ‚dissidenten‘ Position zum innerparteilichen ‚Machtzentrum‘ heraus für ihre Vorschläge werben müssen … Siehe auch: https://www.jacobinmag.com/2017/02/spain-pablo-iglesias-errejon-podemos-anticapitalistas-vistalegre-ciudadanos/
[3] Podemos ist nicht Mitgliedspartei der EL; Izquierda Unida aus Spanien ist dies hingegen seit deren Gründung. Politisch hat das alte Führungsduo von Podemos um Iglesias und Errejón stets die Nähe ihrer Formation zu Konzepten der EL betont. Kritisch zur EL und alledem siehe meinen Beitrag in Z Nr. 97 vom März 2014.
[4] Um nicht missverstanden zu werden: ich bin kein Anhänger der Populismus-Strategie von Laclau und Mouffe. Ich finde es aber sinnvoll, Argumentationen (egal ob ich sie teile oder nicht), auf ihre ‚inhärente‘ Schlüssigkeit hin zu überprüfen. Sind diese logisch konsistent mit der Linie, wie sie von den entsprechenden AkteurInnen selber vorgetragen wurde?