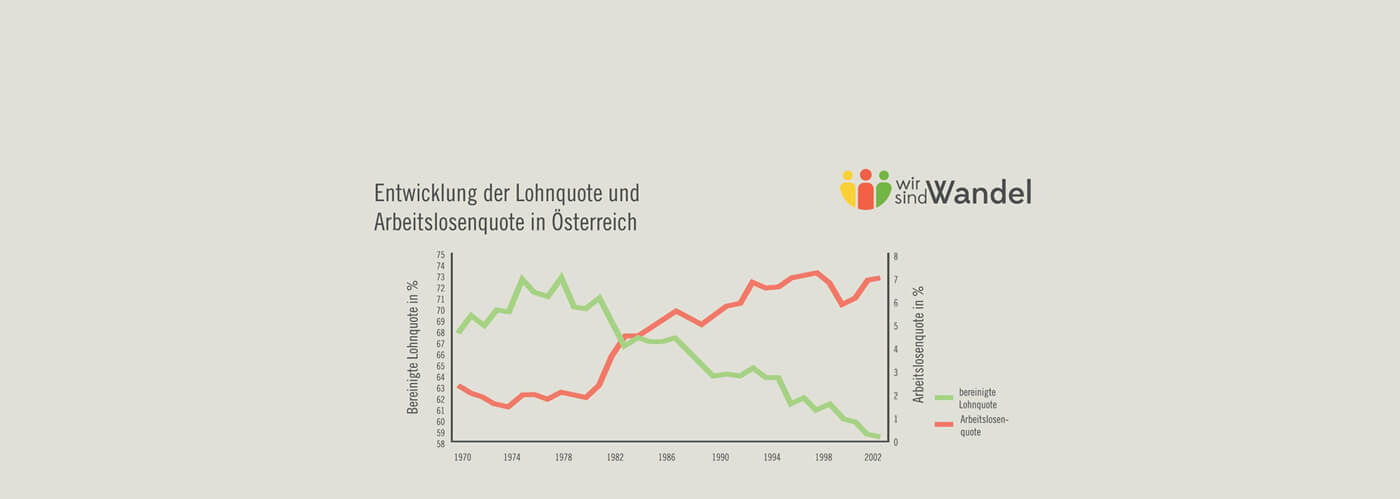Chronologie des Weges zu Neuwahlen in Spanien
Spanien steckt in einer Situation, wie sie den europäischen Eliten in naher Zukunft öfters bevorstehen wird: breite Schichten der einfachen Bevölkerung wollen nicht mehr so weiter regiert werden wie bisher und die herrschenden Klassen können es nicht mehr. Konkret haben die spanischen Wahlen vom 20. Dezember eine parlamentarische Konstellation hervorgebracht, die die lange (für die Eliten) erfolgreiche Alternanz zwischen den beiden Großparteien PP (Partido Popular, Volkspartei) auf der Rechten und PSOE (Partido Socialista Obrero Español, Spanische Sozialistische Arbeiterpartei) auf der Linken durchbrochen hat. Stein des Anstoßes ist der Erfolg der neuen Protestpartei Podemos (Wir können) mit über 20 % der Stimmen. Die Großparteien verloren dagegen massiv an Zuspruch und konnten, trotz des Wahlgesetzes, das große Parteien deutlich privilegiert, keine Regierung im Sinne der Eliten bilden.
Regieren für die Eliten bedeutet im spanischen Kontext im Wesentlichen zwei Dinge: (i) Kontinuität in der Wirtschaftspolitik mit Austerität (konkret verlangt die EU-Kommission eine Reduktion des Budgetdefizits auf 2,8 % für 2016) und sozialer Härte (Beibehalten der prekären Beschäftigungsverhältnisse, die durch die Arbeitsmarktreformen von 2010 durch die PSOE und 2012 durch die PP fixiert wurden; weitere Kürzung der Pensionen) und (ii) Unnachgiebigkeit gegenüber den Unabhängigkeitsambitionen in den Regionen, allen voran Kataloniens und des Baskenlands.
Der Schreck der spanischen Eliten über den Wahlausgang war umso größer, also sie massiv durch Selbsttäuschung über den Erfolg ihres wirtschaftlichen „Reformpfades“ gedopt sind: die Wirtschaft wächst wieder mit 1,4 % 2014 und 3,2 % 2015 und die Arbeitslosigkeit fiel von ihrem Höchststand mit 25,8 % 2012 auf 20,9 % 2015. Die „Erholung“ führte aber auch rasch wieder zu einer Verschlechterung der Leistungsbilanz und ist wie in anderen Ländern eher durch äußere Einflüsse begründet (niedriger Ölpreis, niedrige Zinsen) denn durch eine irgendwie geartete Stärkung der wirtschaftlichen Fundamente des Landes. Seit Mitte der 1980er erodiert Spaniens wirtschaftliches Fundament: Ausbleibende Modernisierung der Industrie gefolgt von deren Abwanderung nach Osteuropa und Asien, mit dem EU-Beitritt Übergang zu einer peripheren Dienstleistungsökonomie mit ständig negativer Leistungsbilanz und einer chronischen Arbeitslosigkeit um die 20 %, unterbrochen nur durch den Rausch der Immobilienblase zwischen 2002 und 2008. Auch die Staatsverschuldung (127 % des BIP) und die private Verschuldung (228 % des BIP) sind weit weg, um den Jubel der Eliten zu legitimieren. Aber gerade in Wahlzeiten wird gerne mit der Aussicht auf ein Ende der mageren Jahre geworben und die Hoffnungsbotschaften der eigenen PR-Institute wurden wohl verinnerlicht. Man spürte richtig, wie hart es war, als Finanzminister Cristóbal Montoro (PP) am 31. März das klägliche Scheitern des Defizitziels (3,2 % für 2015, real 5,2 %) verkünden musste (um gleich den verschwenderischen Regionen die Spar-Rute in Fenster zu stellen; die rebellischen Katalanen sollten nicht denken, sie könnten im spanischen Rahmen Sozialstaat spielen!).
Schon vor den Wahlen war den Mächtigen in Spanien klar, dass stürmische Zeiten auf sie zukamen. Die erste Idee, um ihre Herrschaft abzusichern, war die Gründung der Newcomer-Partei Ciudadanos des eingeschworen pro-spanischen Katalanen Albert Rivera. Ciudadanos sollte einerseits mit einem modernen Flair die unzufriedenen Mitte-rechts Stimmen kanalisieren, die sich vorhersehbar von der durch Korruptionsskandale maroden PP abwenden würden. Andererseits hoffte man sie als Gegenpol zu Podemos aufbauen zu können, indem man mit dem jugendlich-smarten Parteichef Rivera einen neoliberalen Antipode zu Pablo Iglesias aufbaute, der ebenfalls gegen das verkrustete Establishment zu Felde zog. Das Manöver scheiterte jedoch: Ciudadanos blieb mit 13,9 % deutlich hinter den Erwartungen und konnte nicht zum Königsmacher einer der Altparteien werden. Versuch Nummer 1 der Eliten war damit gescheitert.
Nachdem der Scherbenhaufen des 20. Dezember klar war, lancierte man in Phase 2 die Notwendigkeit einer großen Koalition, indem man die Angst vor Unregierbarkeit an die Wand malte, welche die „Erfolge“ der ökonomischen Erholung zunichtemachen würde. Die EU und wohl auch Teile der spanischen Wirtschaftsgranden hätten dies gerne gesehen. Die Möglichkeiten der großen Koalition standen aber schlecht. Die PSOE konnte sich nach einem „linken“ Wahlkampf gegen die Kontinuität der PP – getrieben durch das Damoklesschwert Podemos – auf eine solche Regierungskonstellation schlecht einlassen. Es wäre ihr sicherer Weg zum PASOK-Schicksal gewesen. Und die PP begann bereits bald nach der offensichtlichen Unmöglichkeit einer von ihr geführten Regierung Rajoy II mit Neuwahlen zu liebäugeln. Prognosen ließen auf eine weitere Schwächung der PSOE und damit vielleicht doch noch eine Mehrheit PP-Ciudadanos hoffen.
Es begannen also Phase drei: Die Verhandlungen um eine Regierung unter PSOE Chef Pedro Sánchez. Dabei standen zwei Optionen zur Diskussion. Einerseits eine linke Koalition mit Podemos, IU (Izquierda Unida, Vereinigte Linke) und dem valenzianischen Linksbündnis Compromis. Andererseits eine Konstellation mit Ciudadanos im Boot. Der erste Weg einer „Regierung des Wandels“ bekam bald den Beinahmen der portugiesischen Option, die Sánchez selbst durch einen symbolischen Besuch Anfang Januar bei seinem dortigen Kollegen Antonio Costa, Ministerpräsident einer von Kommunisten und Linksblock gestützten Regierung, anzuvisieren schien. Podemos nannte es dann die valenzianische Option (Valencia wird durch eine Koalition aus Sozialisten, Podemos und Compromis regiert) oder den Weg der 161 (nach der Stimmenzahl der vier Parteien im Parlament). Für die Elite war diese Option jedoch nicht akzeptabel. Man wollte sich nicht auf die Unwägbarkeiten einer Regierung einlassen, deren Entscheidungen vom Goodwill von Podemos abhingen und schon gar keinen Vizepremier Pablo Iglesias.
Zunächst schickte man die PSOE-interne Rechte unter Führung der „Barone“ (jener Parteigranden aus den Provinzen unter Führung der andalusischen Regierungschefin Susana Diaz) in die Schlacht. Ihre Kampagne gegen eine von Podemos abhängige Koalitionsregierung fokussierte auf die Frage eines Unabhängigkeitsreferendums (das „Recht zu entscheiden“, wie es verklausuliert genannt wird). Es war die politische Phase, als in Katalonien die Regierungsbildung von der Entscheidung der radikal-linken CUP (Candidatura d’Unitat Popular, Kandidatur der Volkseinheit) abhing. Dies bot sich hervorragend an, gegen eine linke Koalition mit Podemos zu wettern. Podemos unterstützt, zwar in moderater Form und vielleicht vor allem aus Rücksicht auf seine regionalen Partner in Katalonien und im Baskenland, die der Partei ihr starkes Ergebnis bei den Dezemberwahlen brachten, das demokratische Recht, ein Unabhängigkeitsreferendum abzuhalten. Die „Barone“ marschierten daher unter der Fahne der Gefahr für die Einheit Spaniens auf, wohl wissend, dass dies eine rote Linie für weite Teile des Establishments darstellt und daher der Druck auf Sánchez entsprechend hoch sein werde.
Sánchez konnte sich jedoch durch ein geschicktes Manöver der Umarmung der „Barone“ entziehen, die mit dem Scheitern des Versuchs einer Linksregierung auch gleich seinen Kopf in der Partei rollen sehen wollten: er sicherte sich durch eine Befragung der Basis sein Mandat für weitere Verhandlung mit allen Parteien, stärkte damit seine parteiinterne Position und brachte das Manöver zum Scheitern.
Dennoch hatte dieser Angriff wichtige Nachwirkungen. Man soll sich keine Illusionen über Pedro Sánchez als linker Politiker machen, der etwa die sozialen und demokratischen Probleme des Landes konsequent anzugehen bereit sei. Sánchez ist sich durchaus bewusst, dass dies nur mit schmerzhaften Brüchen mit den Eliten des Landes und der EU machbar ist, dass es dabei „rote Linien“ zu überschreiten gilt und auch dass Podemos keine Kraft ist, die ohne weiteres vor den Karren eines leicht getarnten Programms der Fortführung des Status Quo gespannt werden kann.
So begann die zweite Option zu reifen, deren Kernelement wiederum Ciudadanos war. Statt einer Linksregierung brachte Sánchez eine breite Koalition aus PSOE, Ciudadanos und Podemos ins Gespräch: der Weg der 199 (wiederum nach den Stimmen dieser drei Parteien im Parlament) statt des Wegs der 161. Im Wesentlichen sollte es darum gehen, ein gemeinsames Programm zu verhandeln und auf dieser Basis Sánchez zum Ministerpräsidenten zu küren. Dagegen war das Modell einer Linksregierung, das Podemos vorschlug, eine Koalition mit relevanten Ministerposten auch für die anderen beteiligten Parteien. Dagegen wurde das mediale Geschütz aufgefahren, Iglesias ginge es nur um Postenschacher statt um ein Programm des Wandels. Seine Forderung, Positionen zu verhandeln war jedoch äußerst intelligent, gab sie doch dem „Inhalt“ eine entsprechende „Form“: kein Verhandlungskompromiss ohne entsprechende Macht, die eigenen Forderungen auch durchzusetzen.
Die Elite schien sich recht rasch darüber im Klaren gewesen zu sein, dass die Dreierkoalition PSOE, Ciudadanos und Podemos nicht zustande kommen würde. Vielmehr dürfte diese Option für den Machtapparat eine Form gewesen sein, die Schlacht in Richtung Neuwahlen vorzubereiten und dabei Podemos möglichst großen Schaden zuzufügen. Ende Februar unterschrieben Pedro Sánchez und Albert Rivera einen Pakt für eine Regierungskoalition, der zu einer zentralen Waffe des Angriffes auf Podemos wurde. Es begann mit leichter Munition: Podemos als Verhinderer einer Regierung des Wandels, der mit überzogenen Forderungen das Spiel der PP mache.
Nach und nach brachte man schwerere Geschütze in Stellung. Ziel war es, interne Konflikte in Podemos medial zu tiefen Gegensetzen und Spaltungstendenzen aufzublähen. Es begann mit Schwierigkeiten in mehreren territorialen Sektionen in der ersten Märzhälfte, mit Rücktritten der Parteiführer in Galizien und Madrid. Im Zuge dieser territorialen Krisen wurde die Person des Organisationssekretärs Sergio Pascual abgesetzt. Dies wiederum wurde in den Medien zu einer Spaltung zwischen Pablo Iglesias und der „Nummer zwei“ von Podemos Íñigo Errejón gemacht, dessen Abteilung der Organisationssekretär zugehörte. Hier sei besonders auf El Pais hingewiesen, das „Zentralorgan“ der Machteliten der PSOE (inklusive dem immer noch sein Unwesen treibenden Ex-Premier Felipe Gonzales), das über Wochen über die bevorstehenden Spaltungen von Podemos sinnierte. Prompt erschienen dann auch erste Umfragen über die Stimmenverteilung bei eventuellen Neuwahlen, die ein Absinken von Podemos auf 16 % und damit deutlich hinter die PSOE und Ciudadanos prognostizierten.
Dieser letzte Akt der Offensive der Eliten war ein wahrhaftes Lehrstück modernen Klassenkampfes mit den Waffen der Medien und in einer Konjunktur, wo Wahlen zum wichtigsten Schlachtfeld zwischen den alten Oligarchien und den neu entstehenden Oppositionsströmungen geworden sind. Daher verdient dies etwas genauer kommentiert zu werden. Podemos ist keine Partei mit traditionsreicher und konsistenter ideologischer Ausrichtung, sondern ein „postmodernes“ Sammelsurium oppositioneller Ideen und Strömungen: Leute aus der KP/IU-Tradition (zu denen Pablo Iglesias zählt), die Strömung der „Anticapitalistas“ trotzkistischer Provenienz (die prominentesten Namen sind Teresa Rodríguez, Parteiführerin in Andalusien und der Europaparlaments-Abgeordnete Miguel Urbán; diese firmierten auch als Organisatoren des Plan-B Events im Februar 2016 in Madrid), Postmarxisten aus der Antiglobalisierungskultur mit starker Prägung durch die neue lateinamerikanischen Linken (Bolivien, Venezuela), zu denen Íñigo Errejón zählt, Teile des linken Nationalismus in den Regionen, und sicher eine Masse an ideologisch nicht festgelegten Krisenopfern und über die traditionelle Polit-Elite empörte Leute. Diese ideologische Vielfalt in Podemos und das rasante Wachstum seit den Europawahlen 2014 machen Konflikte unvermeidlich. Als wesentliche Fragen haben sich dabei herausdestilliert: (i) die Wahlallianzen (Wahlbündnisse gleichberechtigter Partner vs. Podemos mit Listenplätzen für die Kandidaten anderer Gruppierungen), (ii) die Struktur der Partei (starker zentraler Apparat mit dominanter Rolle der Abgeordneten vs. Einfluss der Basiskomitees), und (iii) die politisch-soziale Orientierung und der entsprechende Diskurs (Linke vs. „Transversalidad“, also gesellschaftliche Breite im Sinne des für Podemos konstitutiven Paradigmas „Volk gegen Kaste“). Diese realen Debatten und Konflikte, die es in der angespannten Situation der Nachwahlperiode auszubalancieren galt (was dem Organisationssekretär Pascual eben nicht gelungen war), wurden von El Pais aufgegriffen, mit dem Ziel sie in der Öffentlichkeit zuzuspitzen und als tiefe Krise von Podemos zu inszenieren – gespickt mit zahlreichen Seitenhieben gegen den autoritären Führer Iglesias und die Degeneration von Podemos zu einer hierarchischen Partei im alten Stil.
Trotz dieses massiven Angriffs und Druckes, schien keine Strömung oder Führungsfigur in Podemos eine bedingungslose Unterstützung einer PSOE-Regierung bzw. des Paktes PSOE-Ciudadanos in Betracht gezogen zu haben. Allen war wohl klar, dass dies den Untergang von Podemos eingeläutet hätte.
Nach dem Scheitern der Dreiergespräche PSOE, Ciudadanos, Podemos am 7. April (die PSOE beharrte auf ihrem mit Ciudadanos unterzeichneten Pakt) ist nun klar, dass es keine Regierung Sánchez geben wird. Die große Koalition, der Traum der Oligarchie, die die PP nun rhetorisch wieder aufs Tapet gebracht hat, ist nach wie vor unrealistisch. Es wird nun im letzten Akt vor der offiziellen Ausrufung von Neuwahlen wohl nur mehr darum gehen, wer den „schwarzen Peter“ für den neuerlichen Wahlgang umgehängt bekommt. Podemos hat bereits mit einer Basisbefragung gegengesteuert. Der offene Wahlkampf wird also in Kürze beginnen.
Abschließend seien zwei Dinge unterstrichen:
- Die Angst der Elite ist mehr vor der politischen Situation, die eine Regierung mit Podemos eröffnen könnte, nicht so sehr vor dem Programm der Partei. Auch unter der griechischen Syriza steuerte das Land auf einen Bruch mit der herrschenden Ordnung zu, ohne dass das von der Führung so gewollt war (Juli-Referendum). Mit Podemos als nahezu gleichberechtigter Teil in einer PSOE Regierung, inklusive Minister, müsste die Elite mit Kräften ein Auskommen finden, die ihr noch nicht vertraut sind und die erst domestiziert werden müssen. Dieser Unsicherheit will sich die Oligarchie offenbar nicht stellen. Insbesondere die nationale Frage (Katalonien, Baskenland) könnte in einem solchen politischen Umfeld äußerst explosiv werden. Es ist also nicht Podemos als Partei und ihr Programm als solches, die einen Bruch mit der Oligarchie auslösen würde, sondern die politische Dynamik, die eine Regierungsbeteiligung von Podemos katalysieren könnte.
- Wie in Griechenland müsste sich eine Regierung gegen die Eliten dem europäischen Korsett stellen, das die Austerität auch in Spanien in die Verfassung geschrieben hat (Artikel 135). Podemos ist wie Syriza weit davon entfernt, sich der Bedeutung dieses unvermeidlichen Konflikts bewusst zu sein und programmatisch darauf einzulassen. Dementsprechend ist auch in Spanien eine Situation möglich, wie in Griechenland zur Zeit des Juli-Referendums: die politische Dynamik drängt auf einen Bruch und die vorhandenen Kräfte können und wollen diesen nicht organisieren. Um dieses künftig mögliche politische Vakuum zu vermeiden, sind auch in Spanien die Kräfte der Anti-Euro-Linken entscheidend. Die Tragik, den Widerspruch zwischen objektiven Chancen und subjektiven Möglichkeiten nicht aufzulösen, könnte sich aber auch in Spanien wiederholen. Der Versuch einer europäischen Koordination der Anti-Euro-Linken ist ein Versuch, gegen die Wiederholdung der griechischen Geschichte koordiniert vorzuarbeiten.
Gernot Bodner, www.euroexit.org
Wien 10. April 2016