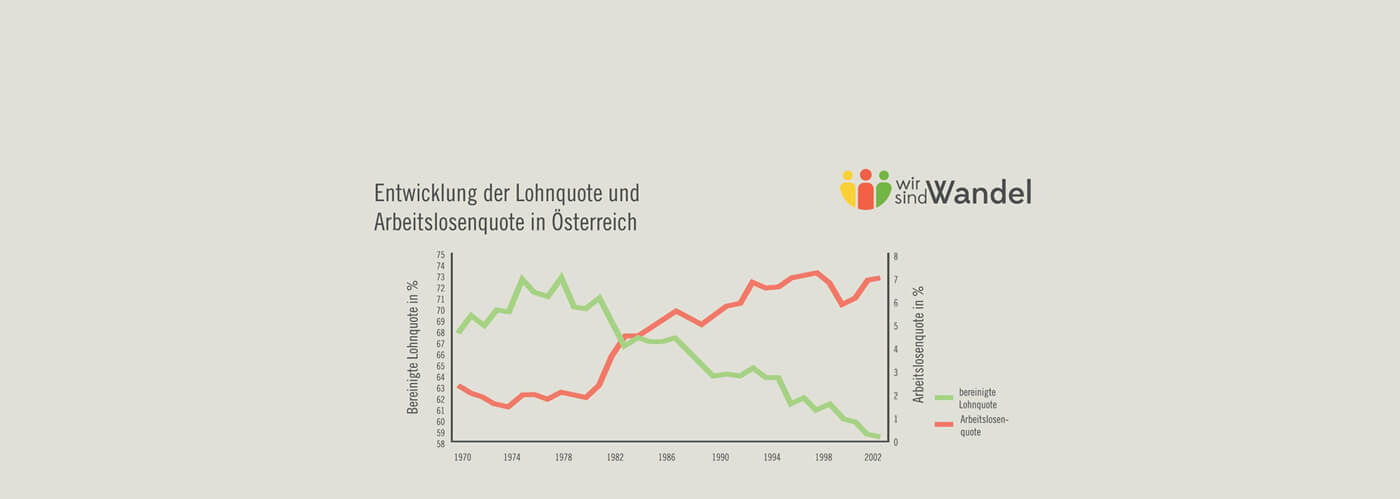von Wilhelm Langthaler
Podemos’ Wahlerfolg scheint griechische Katastrophe vergessen zu machen
Am 23.-24. Januar fand in Paris die Plan-B-Konferenz statt. Aufgerufen hatten fünf nicht mehr amtierende Minister oder politische Amtsträger, namentlich Stefano Fassina, Yanis Varoufakis, Jean-Luc Mélenchon, Zoe Konstantopoulou und Oskar Lafontaine. Damals standen alle unter dem Schock der griechischen Ereignisse, als die deutschen Finanzpanzer die griechische Volksrevolte niederwalzten: ein Plan B zum Widerstand gegen das Euro-Regime war offensichtlich notwendig geworden.
Doch liest man den Aufruf genau, so stellt sich schnell heraus, dass der Name selbst das radikalste an ihm ist. Tatsächlich geht es nur um den altern Hadern der Neuverhandlung der EU-Verträge. Der Euro-Austritt diente lediglich als Drohgebärde, um den gescheiterten Plan A der sozialen EU durchzusetzen. Als wollte man den Referendum-Bluff Tsipras’ und Varoufakis’ auf höherer Stufenleiter wiederholen.
Doch dann kam im Dezember der Wahlerfolg von Podemos in Spanien, der auf der Basis der Unterstützung der Tsipras-Linie erfolgte. Angesichts des wesentlich höheren Gewichts Spaniens bekamen jene, die den Bruch mit dem Euro-Regime vermeiden wollen, Wasser auf ihre Mühlen und die todgeglaubte soziale EU begann wieder in den linken Köpfen herumzuspuken.
Die ursprünglich bereits für den vergangenen November anberaumte Konferenz hatte man verschoben – wegen der Pariser Terroranschläge, wie die Organisatoren der französischen Linksfront und –partei versicherten. Bereits das verrät einiges über die Stellung der Veranstalter zum herrschenden System. Denn tatsächlich wurde die Konferenz durch den antidemokratischen und hysterischen Ausnahmezustand der französischen Regierung verunmöglicht, den Mélenchon bis heute unterstützt!
Scheinbar hatte sich der Medienstar Varoufakis dank der verlängerten Bedenkzeit eines Besseren besonnen und hat vor einem allzu wilden Plan B Abstand genommen, zugunsten eines Plan C, der nichts anderes ist als sein alter, gescheiterter Plan A. Er war daher in Paris nicht erschienen – sicher nicht zum Schaden der Konferenz.
Den Anfang machte Oskar Lafontaine mit einer sehr klaren, konzisen und bestimmten Rede: Der Süden könne nicht auf einen sozialen Schwenk in Deutschland mit seinem Lohndumping warten, denn das wäre ein Warten auf Godot. Der Austritt aus dem Euro und die Rückkehr zu einem System von politisch kontrollierten Wechselkursen sei eine unbedingte Notwendigkeit. Statt eines Quantitative Easing zugunsten der Banken bedürfe es direkter staatlicher Investitionen. Die Zentralbank und die Geldpolitik müssten unter demokratische Kontrolle genommen werden und den Interessen der Mehrheit untergeordnet werden. Aber er griff auch die westliche imperialistische Politik der Kriege an, verurteilte die Unterordnung unter die USA und wies darauf hin, dass es erst diese Politik sei, die die Flüchtlingsströme hervorrufen würde.
Lafontaine formulierte ein echtes soziales und demokratisches Programm für Mehrheiten – den Plan B!
Wie das allerdings mit Gysis Rot-Grün im Dienste der deutschen Exportindustrie und Unterordnung unter die US-Außenpolitik zusammengeht, blieb Lafontaine den Zuhörern schuldig.
In den folgenden Diskussionen legten einige mehr, andere weniger bekannte Figuren noch nach. Lapavitsas, der ehemalige Syriza-Abgeordnete, der immer für den Bruch eingetreten war, formulierte präzise: nationale Währung, Streichung der Schulden, Kapitalverkehrskontrollen, Verstaatlichung des Finanzsektors, demokratische Souveränität über den Staat und ein Ende der postnationalen, globalistischen Ideologie der Linken, die die Subalternen den supranationalen neoliberalen Eliten auslieferte. In eine ähnliche Kerbe, wenn auch nicht immer so bestimmt, schlugen die Ökonomen Brancaccio (Italien), Lordon (Frankreich) oder Höpner (Deutschland) – und einige andere mehr.
Am Sonntag blies Stefano Fassina, der vergangenes Jahr noch für eine breite Front für die nationale Verteidigung gegen das Euro-Regime eingetreten war, dann aber zum Rückzug. Es bedürfe unbedingt der Fortsetzung des Plan A, so politisch unrealistisch der auch sei. Er hoffe auf eine Wiederbelegung der alten Sozialdemokratie, wie es unter Corbyn gerade in England stattfinden würde. Den Plan B müsse man in der Hinterhand behalten. Diese Haltung korrespondiert mit seinem verzweifelten Versuch in Italien eine Linke ins Parlament zu führen, die weiterhin an der EU eisern festhält, während Umfragen Mehrheiten für einen Euro-Austritt ausweisen.
Den Vogel schoss dann Mélenchon in der Abschlussrede ab. Er degradierte die Teilnehmer aus ganz Europa zu Statisten für die Wahlrede eines Demagogen und Populisten, der sich in Selbstgefälligkeit und leerem Pathos kaum von dem Rest der französischen politischen Klasse unterscheidet. Einzige politische Aussage zum Thema: Neuverhandlung der EU-Verträge. Sonst billiges Geschimpfe auf den Kapitalismus, die Finanzmärkte, die Banken, Draghi, Merkel, Brüssel, das EU-Parlament bla bla bla. Er ließ es nicht aus, mainstreammäßig die Täter von Köln zu verdammen, aber fügte quasi sich absichernd hinzu, dass er “gegen alle Kriminellen” sei, sozusagen auch jene im Nadelstreif. Er attackierte Erdogan und machte Anspielungen, dass der moderate Islamist vielleicht doch ein islamischer Faschist sei – ohne ein Wort der Kritik an der islamophoben französischen Staatsdoktrin. Zum Schluss rief er die spanischen Mandatare von IU und Podemos auf die Bühne, alle blutjung, und überreichte ihnen eine rote Rose als väterlicher Freund – mit der Quasi-Prätention intellektueller Architekt ihres Erfolges zu sein. Die alte „mission civilicatrice“ quillt aus allen Poren.
Nun müsst en die Franzosen nur mehr richtig wählen, um das gleiche wie in Spanien und Portugal zu ermöglichen. Denn der Wahlerfolg würde die Koalition mit der PSOE erst möglich machen. Er zielt auf eine Koalition mit der PS hin (unausgesprochen als Juniorpartner und damit als Mehrheitsbeschaffer) und kritisierte die SPD, dass sie nicht Rot-Rot-Grün eingehen würde. Eine völlige Verkennung des herrschenden Regimes. Oder aber eher: er ist selbst Teil dieses Regimes.
Ein Plan B, der ernstgenommen werden will und eine echte soziale Alternative sein soll, muss mit Mélenchon und Konsorten brechen. Die Lehren aus Griechenland müssen klar und deutlich gezogen werden und werden wohl demnächst auch in Portugal und Spanien auf die Probe gestellt werden: Vorbereitung auf den Bruch mit dem Euro-Regime!
Ein tiefer Graben muss uns von den Linksblinkern des Systems trennen, die es nicht ernst meinen und den verzweifelten politisch-sozialen Protest nur für ihre (unmögliche) Rückkehr an die Macht nutzen wollen (in Wirklichkeit für ihr politisches Überleben). Mit solchen Kräften kann auch nicht den rechten Sozialpopulisten wie der Front National begegnet werden, die für sich – leider nicht ganz unberechtigt – in Anspruch nehmen, die einzige Opposition gegen das Euro-Regime zu sein.
Viele der Teilnehmer, vielleicht sogar die Mehrheit, meint, dass man Varoufakis, Mélenchon etc. gegenwärtig brauche, um Kräfte zu sammeln. Tatsächlich sind sie aber ein Hindernis, um zu einer Alternative zu werden. Nicht so sehr im linken Milieu, aber viel mehr in den unteren Schichten. Denn der Zusammenstoß mit der Oligarchie kommt bestimmt (vielleicht schneller als man annehmen würde) und es tut sich bei den Subalternen ein Vakuum auf. Für die Linke als Linke wird es wohl so schnell keine Mehrheiten geben, für eine soziale und demokratische politische Führung des Bruchs kann das aber sehr schnell sehr wohl der Fall sein – in Griechenland gab es dafür eine Zweidrittelmehrheit beim Referendum, die von der „Radikalen Linken“ (so der Namen von Syriza) verraten wurde.
Varoufakis und ein Teil von Podemos treiben den Plan B vor sich her und haben für Februar in Madrid scheinbar unilateral eine weitere Konferenz angesetzt, die abermals für die soziale EU, den Plan A-C, eintritt. Auch dort wird man sich der Auseinandersetzung stellen müssen.
Konkreter Vorschlag an die gesamte Bewegung ist eine Koalition für einen echten, klaren Plan B zur Beendigung des Euro-Regimes zu bilden, der sehr sich auch gegen den neoliberalen Binnenmarkt und die EU als Exekutor der liberalen Oligarchie richten muss, genauso wie gegen die Nato als deren militärischen Arm.
Zu diesem Zweck schlägt die Internationale Koordination gegen den Euro, die aus Gruppen in Griechenland, Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und Österreich besteht, ein europäisches Forum vor, das vom 23.-25. September in Italien unter dem Arbeitstitel „Welche Alternativen zum Euro-Regime“ stattfinden soll.